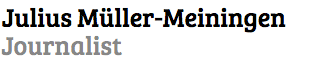Um zu verstehen, was diesen Mann antreibt, muss man mit ihm eine Zeitreise zurück in die Siebzigerjahre machen. Robert Sarah hat gerade sein Theologiestudium in Jerusalem beendet, als er zum Pfarrer einer Kleinstadt an der Atlantikküste seines afrikanischen Heimatlandes Guinea ernannt wird. Rom und der Vatikan sind eine Ewigkeit entfernt. Sarah ist noch nicht einmal 30 Jahre alt. Mit einem Koffer auf dem Kopf, in dem die Utensilien zum Feiern der Messe stecken, wandert er zu Fuß durch das Land. Christen sind in Guinea eine Minderheit, das kommunistische Regime hat den katholischen Erzbischof in ein Lager gesteckt. Zwischen Atheisten und Muslimen, verfolgt von den Schergen des Regimes, verkündet Sarah die Wahrheit. An diesem Sonntag beginnt im Vatikan die ordentliche Bischofssynode zum Thema Familie. Wieder einmal geht es um Wahrheit, wie eigentlich immer im Leben von Robert Sarah. Auch diesmal steht viel auf dem Spiel, vielleicht sogar die Richtung, in die sich die gesamte katholische Kirche bewegt. Der 70 Jahre alte Sarah ist längst zum
einflussreichen Kardinal aufgestiegen, seit 2001 wirkt er an der Kurie, im vergangenen Jahr ernannte ihn Franziskus zum Präfekten der Kongregation für den Gottesdienst. Aber Sarahs Haltung ist immer noch die des barfuß durch die afrikanische Diaspora stakenden Missionars. Alle Sätze, die nun so aufsehenerregend klingen, erklären sich aus dieser Erfahrung. Sarah sagt: »Ich bin sicher, dass das Rot meiner Kardinalswürde tatsächlich der Widerschein des Blutes vom Leiden der Missionare ist, die bis ans Ende Afrikas kamen, um in meinem Dorf das Evangelium zu verkünden.« Blut und Wahrheit, das sind im Leben dieses Geistlichen entscheidende Parameter, mit denen man in Westeuropa heutzutage Schwierigkeiten hat. Robert Sarah entstammt dem Eingeborenenvolk der Coniagui, das im Niemandsland an der Grenze zum Senegal lebte. Seine Eltern wurden zum katholischen Glauben bekehrt und tauften ihren einzigen Sohn. Der geriet in jungen Jahren mehrmals in Lebensgefahr, weil er Christ ist. Mit 34 Jahren wurde er zum jüngsten katholischen Bischof überhaupt geweiht. Dieser gebildete…