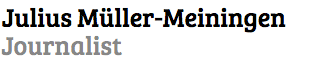Politiker sind nicht die Spezies, die das italienische Volk in Jubelstürme ausbrechen lässt. Auch der designierte Ministerpräsident Paolo Gentiloni löst bei seinen Landsleuten keine ekstatischen Reaktionen aus. Aber er kann immerhin für sich beanspruchen, nicht zur Kategorie der unbeliebtesten Gestalten im römischen Politikbetrieb zu zählen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass viele Italiener Gentiloni gar nicht kennen. Und zweitens damit, dass der 62-Jährige, der seit 2014 als Außenminister amtierte, für seine besonnene Art bekannt ist. Nur eine gute Woche nach dem Rücktritt von Premier Matteo Renzi könnten Gentiloni und seine Regierung bereits an diesem Dienstag von Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigt werden. Einen „wunderbaren Kollegen“ hat Bundesaußenminister Frank-Walter-Steinmeier seinen Amtskollegen vor dessen Vereidigung genannt. Das sind Worte, die weit über das normale Maß an Freundlichkeit herausgehen und wohl damit zu tun haben, dass Gentiloni sich nicht nur auf dem internationalen Parkett zu bewegen weiß. Der Politiker spricht Englisch, Französisch und nach einem Kurs beim Goethe-Institut offenbar auch passabel Deutsch. „Er hat die Diplomatie im Blut“, schrieb der Corriere della Sera. Dem künftigen Ministerpräsidenten wird eine Akribie und Bedächtigkeit nachgesagt, die man zuletzt nicht mehr kannte aus Italien. Vorgänger Renzi wurde in Brüssel und Berlin
einerseits für seinen Elan geschätzt, er war aber auch als große Nervensäge verschrien. Beides kann man vom verbindlichen Gentiloni nicht behaupten. Der Römer entstammt einem alten, katholischen Adelsgeschlecht, das immer noch einen ganzen Palazzo in der Nähe des Viminal-Hügels in Rom besitzt. Auch Gentiloni wohnt hier mit seiner Ehefrau und liebt es, zu Fuß durch die Stadt zu flanieren. Ein Großonkel des designierten Ministerpräsidenten vermittelte 1913 den sogenannten Gentiloni-Pakt zwischen Vatikan und Regierung. Anschließend durften auch die italienischen Katholiken an demokratischen Wahlen teilnehmen, Papst Pius IX. hatte ihnen dies verboten. Dass auch der künftige Ministerpräsident einen guten Draht zur Kirche hat, ist bekannt. Gentiloni ist ein gemäßigter Katholik, der vor allem als Referent der Stadt Rom für das Heilige Jahr 2000 Bande in den Vatikan knüpfte. Als Student schloss sich der Adelige der außerparlamentarischen Linken an und engagierte sich später in der…