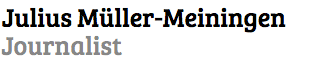In der Forest Street 777 hat die Erzdiözese von Saint Paul und Minneapolis ihren Sitz. Erzbischof Bernard Hebda ist ein umgänglicher Mann. Vor allem hat er langjährige Erfahrung damit, was einer Diözese widerfahren kann, die die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche jahrzehntelang gedemütigt und dann auch noch systematisch übersehen hat. Vielleicht wäre ein Anruf in Minnesota keine schlechte Idee für die deutschen Erzbischöfe und Kardinäle Reinhard Marx (München) und Rainer Maria Woelki (Köln). Woelki will nach einer halbjährigen „geistigen Auszeit“ am Aschermittwoch sein Amt wieder aufnehmen.
Denn die Frage, die nicht nur Woelki, Marx, Hebda, Papst Franziskus und die gesamte katholische Kirche beantworten muss, lautet: Wie geht man mit den Betroffenen von Missbrauch um? Die Frage, vor der sich die Kirche jahrzehntelang gedrückt hat, ist heute ihre Überlebensfrage. Geht sie auf die Betroffenen zu, muss sie sich verändern. Verschließt sie sich weiter, bleibt ihr Kernpostulat von der Sorge um die Seelen ein nicht aufzulösender Widerspruch, ja eine Farce.
Bekannt wurde die Erzdiözese Saint Paul und Minneapolis, als sie 2018 einen spektakulären gerichtlichen Vergleich mit den Betroffenen schloss. 210 Millionen US-Dollar zahlte die Kirche in einen Fonds für die Opfer, die Erzdiözese musste Konkurs anmelden, eine passende Metapher im finstersten aller Kirchenkapitel. Gerade einmal 5000 Euro bekamen Betroffene sexuellen Missbrauchs in Deutschland nach Bekanntwerden des Skandals ab 2010. „Ein Schlag ins Gesicht“, war das nicht nur für Richard Kick, Mitglied im Betroffenenbeirat der Erzdiözese München. Auch die 50 000 Euro, auf die die Deutsche Bischofskonferenz die Zahlungen später beschränkte, waren „eine Demütigung wenn man an die verkorksten Leben, die Depressionen, die Beziehungsschwierigkeiten der als Kinder Missbrauchten denkt“, so Kick.
Gemeinsames Wiedergutmachung-Programm
Anerkennungsleistungen sind das eine. Strafermittlungen, Prävention und Aufarbeitung das andere. Nach der Vorstellung des von der Erzdiözese München und Freising in Auftrag gegebenen Gutachtens Ende Januar, wird nun die Entscheidung der Staatsanwaltschaft München erwartet. Sie prüft 42 Fälle von Fehlverhalten kirchlicher Würdenträger und könnte Ermittlungsverfahren einleiten. In Minnesota einigte sich die Staatsanwaltschaft bereits 2015 mit der Erzdiözese auf einen Vergleich, der kaum bekannt ist, aber den Kern der Frage nach dem Umgang mit den Betroffenen berührt.
Attorney John Choi hatte lange ermittelt. 91 Priester hatten sich in der Erzdiözese über Jahrzehnte hinweg an 450 Betroffenen vergangen, so lauten die offiziellen Zahlen. Mehrere Geistliche kamen in Haft. Aber was, wenn die Opfer entschädigt, die Täter bestraft waren? Welche Verantwortung hat die Kirche dann noch? Choi forderte, die Erzdiözese müsse sich zusätzlich zu allen Maßnahmen zur Veränderung der kirchlichen Strukturen auch dauerhaft um den verursachten emotionalen Schaden kümmern. Die Erzdiözese willigte ein, eine staatliche Zivilklage wurde im Gegenzug fallen gelassen.
In Minnesota setzten Staatsanwaltschaft und Erzdiözese ein gemeinsames Wiedergutmachungs-Programm auf. Seit rund fünf Jahren kommen in Saint Paul und Minneapolis Betroffene, Gemeindemitglieder, Eltern von Opfern und ausgewählte Kleriker in kleinen, moderierten Gesprächszirkeln zusammen, auch Konferenzen werden organisiert. Restorative justice lautet das Zauberwort. Man könnte es mit wiedergutmachender Gerechtigkeit übersetzen. Gemeint ist damit Dialog-Arbeit, um in erster Linie Opfern die Möglichkeit zu geben, die Umstände und Folgen der Verbrechen für ihre Biographien darzustellen, nach den Bedingungen zu forschen, die Missbrauch möglich machen. Betroffene können ihre Wünsche äußern und manche finden ein Stück Frieden. Diese Möglichkeit gibt es sonst nicht, schon gar nicht im Strafprozess. In Minnesota wurde ihr ein Platz geschaffen.
„Wir sprechen über den Schaden der Betroffenen“
Die Frau, die das Programm betreut, ist Janine Geske, Rechtsprofessorin und frühere Richterin am Supreme Court in Wisconsin. Früh morgens nimmt sie in Milwaukee das Telefon ab. „Es geht hier um die Betroffenen“, sagt die ehemalige Richterin, die nun an der Marquette Law School in Milwaukee ein Zentrum für Restorative justice (RJ) aufbaut und der Idee, empathisches Zuhören und Dialog könnten dabei helfen, schwerste Konflikte zu überwinden, selbst erst skeptisch gegenüber stand. „Wir sprechen über den jeweiligen Fall und den Schaden, den er bei den Menschen angerichtet hat“, sagt sie. Damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt, etwa Rechtfertigungsversuchen oder Schuldzuweisungen an die Opfer, die zu Retraumatisierungen führen können, führt Geske monatelang Vorbereitungs-Gespräche, mit beiden Seiten. Sogar als Missbrauchstäter überführte Priester nehmen an den Gesprächen teil. Auch Bischof Hebda, der jeden Freitag Sprechstunde für Betroffene hat, ist dabei. Die Betroffenen äußern sich positiv. Die Erzdiözese gilt als vorbildhaft bei Aufarbeitung und Prävention.
Sprechen darf in den Zirkeln nur, wer das „talking piece“, einen Stein, in der Hand hält. Die anderen müssen der Erzählung des Sprechenden aufmerksam zuhören und dürfen ihn nicht unterbrechen. Es geht bei der RJ nicht um Buße, Strafe oder Vergebung, sondern um den Versuch der Wiederherstellung zerstörter Beziehungen. Das kann unter Umständen zwischen Opfern und Tätern funktionieren, ist aber auch zwischen Betroffenen, Pfarrgemeindemitgliedern und Klerikern möglich. Es handelt sich um eine immer häufiger verwendete, dem Täter-Opfer-Ausgleich ähnliche, erstaunlich effektive Methode. Die Offenheit der Beteiligten, Freiwilligkeit und Vertraulichkeit sind die Voraussetzungen dafür.
„Seelische Transformationsprozesse funktionieren dann, wenn die Teilnehmer bereit für diese Transformation sind“, sagt eine Person, die an Aufarbeitungsprozessen in Deutschland beteiligt ist. „Werden nur Lippenbekenntnisse ausgetauscht, dann klappt es nicht.“ Echte seelische Transformation, auf die die Restorative Justice hinarbeitet, führe dann auch zu Veränderungen im Außen. Das gilt für das Leben der Betroffenen wie für die Verantwortlichen in der Kirche. Wenn sie sich wirklich auf die Opfer und deren Erfahrungen einlassen, wollen, ja müssen sie anschließend etwas ändern.
Begegnung von Opfern und Tätern
Es war vor fünf Monaten, als Gustavo Rovira Salinas den Mann wieder traf, der ihn als Zehnjähriger missbraucht hatte. Rovira lebt heute in Madrid, er ist 53 Jahre alt. Im Salesianer-Kolleg der nordspanischen Stadt Santander hatte ihn Pater S. ein Jahr lang missbraucht. „Sie haben mir die Unschuld geraubt“, sagt Rovira bewegt am Telefon. Rovira las ein Buch des Mediatoren Julian Ríos Martín über Restorative justice („Biographie der Versöhnung“). Es stärkte in ihm den Willen, seiner damals vier Jahre alten Tochter nicht eine von Hass und Groll geprägte Existenz vorzuleben, sondern trotz seiner traumatischen Erfahrungen positiv ins Leben zu gehen. „Ich wollte nicht ewig an meinen Täter gebunden sein“, sagt Rovira.
Es waren die Salesianer selbst, die Rovira dann auf die Idee brachten, selbst so einen Weg einzuschlagen. Sie vermittelten den Kontakt zu zwei Mediatoren. Über Monate hinweg sprach Rovira in regelmäßigen Abständen zunächst nur mit den beiden, insgesamt etwa 50 Stunden lang. „Es geht in der opferorientierten Justiz um die zwischenmenschliche Dimension, die der Begegnung“, sagt Julián Ríos Martín, einer der beiden Mediatoren und Autor des Buches. „Die Aussicht, dem Aggressor den ganzen Schmerz, der sich über Jahrzehnte angesammelt hat, ins Gesicht zu sagen und das in einer Atmosphäre voller emotionaler Sicherheit und einem Mindestmaß an Zuhörqualität, hat einen unbeschreiblichen therapeutischen Wert“, fügt der Rechtswissenschaftler hinzu.
Zeitgleich arbeiteten die Mediatoren mit den Verantwortlichen. Rovira konnte den damaligen Schulleiter in Santander treffen. Er besuchte den Klassenraum, schilderte die Folgen des Missbrauchs. „Das war sehr schwierig“, sagt er, denn einige der alten Lehrer wollten nichts von dem wissen, was passiert war. Sie lenkten ab, taten so, als hätten sie nichts von allem gewusst. Rovira wollte vom Schulleiter wissen, was ihm über den von ihm erlittenen Missbrauch bekannt war, warum geschwiegen wurde und ob es weitere Opfer gab. Das Treffen war kein Erfolg.
„Die ganze Wut ausgekotzt“
Rios und seine Kollegin Clara Herrera Goicochea arbeiteten bislang mit elf Betroffenen und acht Tätern zusammen, von denen vier selbst Opfer waren. „Bislang hat kein Opfer berichtet, dass die Begegnung mit dem Täter in irgendeiner Weise traumatisierend war“, sagt Rios. Im Gegenteil, die Begegnungen hätten die Betroffenen bestärkt. Gustavo Rovira zum Beispiel sagt: „Ich habe keine Angst mehr vor dem Täter, ich fühle mich heute frei von ihm.“ Schon vor dem Treffen mit Pater S. hatte er in den Gesprächen seine „ganze Wut ausgekotzt“, sagt Rovira. „Mich hat dieser restaurative Prozess befreit.“ Mehr als zwei Jahre dauerte die Arbeit.
Das Treffen mit Pater S. dauerte mehr als vier Stunden. Es fand im vergangenen September in einem katholischen Gemeindezentrum in Madrid statt. „Als er vor mir saß, behielt er die ganze Zeit die Fassung“, berichtet Rovira. „Ich habe in ihm schon Reue gesehen, Scham, aber auch die Unfähigkeit, den verursachten Schaden ganz zu spüren und eine enorme Angst, als Pädophiler dazustehen“, berichtet der Betroffene. Manchmal bei dem Treffen hatte Rovira den Eindruck, S. Trage immer noch einen Rüstung, hinter der er sich verstecke. Rovira brauchte ein noch deutlicheres, spürbares Bekenntnis seines Täters.
„Vergibst Du mir?“, wollte Pater S. von Rovira wissen. „Nein“, sagte der. „Ich kann das nicht. Wir müssen diesen Prozess sehr ernst nehmen. Wieviele andere Kinder hast Du vergewaltigt?“ Pater S. antwortete, er wisse es nicht. Rovira will, dass sein Täter den Weg der restaurativen Justiz ganz und nicht nur ungefähr beschreitet, dafür muss auch die ganze Wahrheit auf den Tisch. „Das ist er mir, der Gesellschaft und der Kirche schuldig“, sagt er. Rovira will seinen Peiniger vielleicht wieder treffen. Aber erst, wenn die Mediatoren ihm garantieren, dass der Pater sich weiter innerlich bewegt.
„Vergibst du mir?“
Das erste Treffen beurteilte der 53-Jährige positiv. Rovira sagt, er hatte nach der Begegnung das Gefühl, die Kirche in diesen Wiedergutmachungsprozess gezwungen zu haben. „Das ist für alle gut, für das Opfer, den Täter, die Kirche, aber auch die Gesellschaft“, sagt Rovira. Er wünscht sich, dass die Kirche aus ihrer Lähmung herauskommt, dass sie endlich ihre große Angst vor der Konfrontation mit ihrer Vergangenheit überwindet. „Ich fühlte mich heute gefestigt, erwachsen, frei.“ Er habe den zerrissenen Faden seines Lebens wieder zusammen geknüpft. An Ostern will Rovira in Rom den Ordensoberen der Salesianer treffen. Auch diese Begegnung ist Teil des Dialog-Prozesses.
Am Institut für Anthropologie der päpstlichen Gregoriana-Universität befasst sich der bayerische Jesuit Hans Zollner seit über zehn Jahren mit der Frage, wie Prävention, Aufklärung und Aufarbeitung funktionieren. „Restorative Justice ist ein möglicher und realistischer Weg“, sagt Zollner, Leiter des zusammen mit der Erzdiözese München und Freising seit 2012 aufgebauten Instituts. Mit 100 000 Euro jährlich finanziert die Erzdiözese das frühere Zentrum für Kinderschutz. Zollner baute es zusammen mit seinem Schulfreund aus Regensburger Zeiten, dem früheren Münchner Generalvikar Peter Beer (2010-2019) auf, der heute am Institut für Forschung und Entwicklung zuständig ist.
Zollners Kursangebot in diesem Semester für die Studenten zeigt schon die ganze Bandbreite dessen, was an der Gregoriana zum Thema gemacht wird: „Betroffenen zuhören“, „Bedeutung von Supervision und Begleitung“, „Entwicklung und Updating von Präventionsprogrammen“, „Neudenken der Theologie aus Perspektive der Betroffenen“, „Opferbegleitung“, „Spiritueller Missbrauch“. Ex-Richterin Janine Geske aus Milwaukee gab hier vor Jahren einen Kurs in Restorative Justice, im Frühling wird sie erneut zu einer Online-Schulung nach Rom geschaltet. „Betroffenheit allein genügt allerdings nicht“, sagt Zollner. „Beim Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch 2019 im Vatikan habe ich reihenweise Bischöfe weinen sehen.“ Ob sie dann über ihre Erschütterung hinaus Konsequenzen gezogen hätten, sei eine andere Frage.
Reihenweise weinende Bischöfe
In München ist man auf dem Weg. Das liegt auch an Richard Kick, Mitglied im Betroffenenbeirat und selbst als Kind von einem Priester in einer Münchner Gemeinde sexuell missbraucht. 2010, nach Bekanntwerden der Dimensionen des Missbrauchs auch in Deutschland, wandte er sich an Erzbischof Reinhard Marx und erzählte ihm seine Geschichte. Nach diesem Gespräch, schrieb Kick jetzt in einem offenen Brief an den Erzbischof, „haben Sie meinen Glauben und das Vertrauen in die Institution Kirche durch ihre fehlende Hirtensorge, ihre nicht nur moralischen Versäumnisse und ihrer Untätigkeit völlig zerstört“. Auch Marx wurden im Gutachten Fehlverhalten in zwei Fällen attestiert. Bei seiner Pressekonferenz im Januar gab der Kardinal zu, „die Betroffenen übersehen zu haben“. „Das ist unverzeihlich“, sagte er.
Auch für Richard Kick war Marx von der Bildfläche verschwunden. Der Täter wurde nie bestraft und 2019 beerdigt, „in allen Ehren“ wie Kick erzählt. An den Kardinal richtete er nun einen dringenden Appell, wie ihn die ganze katholische Kirche nötig hätte: „Öffnen Sie Ihr Herz und gehen Sie mit weit geöffneten Armen auf uns Betroffene zu“, fordert der 65-Jährige.
Der Brief klang zunächst nach Konfrontation. Tatsächlich aber hat sich den Beteiligten zufolge seit etwa einem Jahr ein Vertrauensverhältnis zwischen dem unabhängigen Betroffenenbeirat und dem Erzbischof etabliert. Bereits drei Stunden nach der Veröffentlichung des offenen Briefes hatte Marx Kick per email geantwortet, der Betroffenenbeirat steht in regelmäßigem Austausch mit der Bistumsspitze. Beim Erzbischof hat der 65-Jährige eine „steile Lernkurve“ festgestellt. 500 000 Euro seines Privatvermögens gab er in eine Stiftung für Betroffene. Anerkennungszahlungen werden schnell genehmigt, auch Gesprächsanfragen rasch beantwortet.
„Als Betroffene haben wir uns aktiv eingebracht und gesagt, wo der Schmerz sitzt“, sagt Kick. Das sei „unglaublich schwer“ gewesen. Dank dieses Einsatzes gebe es in der Erzdiözese nun aber Einrichtungen, „die helfen“. Seit Januar nimmt eine Hotline mit sechs Psychologinnen und Psychologen die Wünsche der Betroffenen auf, sei es für ein Gespräch mit Verantwortlichen, der Wunsch nach Therapie oder einer Geldzahlung. Bislang konnten Opfer sich nur an überforderte Missbrauchsbeauftragte oder sogar Kirchenmänner wenden, die selbst Teil des Systems waren. Die Einrichtung einer Ombudsstelle mit Mediatoren für Beschwerden und Schlichtung ist in Planung.
Am 21. März wird es in München eine Veranstaltung für Opfer sexuellen Missbrauchs geben. Richard Kick wird sie moderieren, ein Betroffener sowie der Kardinal werden anwesend sein. Die Veranstaltung wird auch per Live-Stream ausgestrahlt, damit Betroffene auch von zuhause zusehen und sich ein Bild machen können. Viermal im Jahr soll es so eine Begegnung künftig geben. „Die Tür ist offen“, sagt Kick, er hofft, dass sich noch mehr Betroffene melden werden.
Dass es zur Wandlung kam, liegt an der Kraft der Betroffenen. Auch sie sind sich untereinander nicht immer einig, wieviel Druck und Aggressivität nötig ist, um einen konstruktiven Prozess einzuleiten und gegen die schwarze Wand anzukämpfen. „Unsere Strategie ist der Dialog, nicht Konfrontation“, sagt Richard Kick über den Münchner Betroffenenbeirat. Nach der Wut gegen den Kirchenfürsten hat sich bei vielen Betroffenen im Bistum die Überzeugung breit gemacht, dass der Erzbischof verstanden habe, „dass es nur mit der Perspektive der Opfer geht“.
Im vergangenen Juni hatte Kardinal Marx Papst Franziskus seinen Rücktritt als Erzbischofs angeboten, der Papst lehnte ab. Marx will es nun weiter versuchen und nach einiger Zeit Bilanz ziehen. Richard Kick sieht den Erzbischof heute als Verbündeten. Marx‘ innerer Veränderungsprozess ist sichtbar. Und dennoch gibt es viele Menschen, die sich fragen, was der Erzbischof nach allem, was passiert ist, noch in seinem Amt zu suchen hat. Richard Kick sagt über den Mann, der von sich selbst behauptet, die Betroffenen lange übersehen zu haben: „Wir brauchen ihn.“