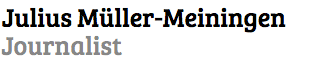Treffpunkt um zwölf Uhr mittags, High Noon in Apulien. Es ist Ende Mai, die süditalienische Hitze hat schon alles im Würgegriff. Ein trostloser, weiter Blick auf Windräder und golden schimmernde Weizenfelder. Im Schatten der Tankstelle schlummert ein ergrauter Schäferhund.
Dann rollt langsam ein silberner Renault Laguna an. Ein alter, weißhaariger Mann mit Pferdeschwanz schält sich mühsam aus dem Fahrersitz. Er trägt schwarze Hose, ein schwarzes, abgetragenes Polo-Hemd, seine schwarzen Turnschuhe haben drei rote Streifen. Nonno Ciccio, der mutmaßlich älteste Ultrà Italiens reicht die Hand. „Ist wie in Afrika hier“, sagt er.
Eigentlich ist man nach Apulien gekommen, um über bedingungslose Anhängerschaft zu sprechen, um die unerschütterliche, lebenslange Liebe eines uralten Mannes zu einem italienischen Drittligisten namens Foggia Calcio. Aber Nonno Ciccio, 91 Jahre alt, will erst einmal vom Krieg erzählen.
Von Hannibal, den Römern, der Schlacht von Cannae, die sich in dieser Ebene vor mehr als zwei Jahrtausenden abgespielt und das Römische Reich an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. „Zehntausende Tote“, sagt der Greis und schüttelt den Kopf. Er humpelt, sein Oberschenkel ist entzündet. An Nonno Ciccios Hals baumelt ein Anhänger mit einer blau schimmernden Kakerlake. „Ein Andenken an die Wüste, El Alamein.“
Nordafrika, die Wüste, der Krieg. Das ist Nonno Ciccios Koordinatensystem, in dem die Leidenschaft für Foggia Calcio eine Art Fluchtpunkt darstellt. Er, der Uralt-Ultrà musste als 17-Jähriger für Hitler und Mussolini in Ägypten kämpfen und hat dabei seine Jugend verloren. „Mörder“, schimpft er. Seither ist Nonno Ciccio nicht nur Antifaschist und Pazifist, er will auch als Ultrà vor allem eines: Frieden.

Francesco Malgieri alias Nonno Ciccio (Fotos: Max Intrisano)
Auf seiner Brust kann man die Choreografie seines Lebens auf einer Handvoll Ansteckern ablesen. Einer davon zeigt ihn als Soldaten, 1942. Daneben ein Medaillon mit einem Foto von einer Auswährtsfahrt nach Benevento und die Wappen der Ultràs von Foggia. Der Alte zieht seine rot-schwarze Kappe auf, auch sie ist übersät mit Glücksbringern und Erinnerungen.
Sein erstes Spiel sah er 1937
Dieser Mann ist nicht nur der wahrscheinlich älteste Fußballfanatiker Italiens, ein Beispiel für irrationale Treue und einen nicht vergehenden, jugendlichen Wahnsinn. Nonno Ciccio ist ein Veteran. In seiner schrulligen Montur gleicht er den alten Männern, die auf Militärparaden hoch dekoriert für ihren Einsatz im Kampf fürs Vaterland geehrt und als überlebende Wracks beklatscht werden. Auch Nonno Ciccio wird beklatscht, im Stadion von den anderen Fans. Ein Wrack will er nicht sein. Er will das Leben, er sucht es auch mit 90 Jahren noch und findet es beim Fußball, vorzugsweise in endlos langen Auswärtsfahrten.
Zur ersten Fußballfahrt seines Lebens bricht Francesco Malgieri im Jahr 1937 auf. So heißt Nonno Ciccio mit bürgerlichem Namen, denn wer in Apulien Francesco getauft wird, den rufen alle nur Ciccio. Nonno, Opa, kam im Alter dazu. Mit einem geklauten Fahrrad und einem Freund radelt der Zwölfjährige 54 Kilometer von seinem Heimatdorf nach Foggia, um erstmals ein Fußballspiel zu sehen.
Wie mit einem schönen Mädchen
17 Jahre zuvor war der Sporting Club Foggia von zwei Mailänder Geschäftsleuten gegründet worden, die dem AC Mailand anhingen. Deshalb sind auch die Vereinsfarben Foggias Schwarz und Rot, im Clubwappen treten ein roter und ein schwarzer Teufel gegen den Ball, in Anlehnung an das Milan-Symbol. 3:0 geht das erste Spiel aus, andere Erinnerungen sind ihm vom Stadionbesuch nicht geblieben, nur ein Gefühl. „Mit Foggia war es wie mit einem schönen Mädchen“, sagt er. „Ich himmelte die Mannschaft an, sie war aber unerreichbar für mich“. Auf dem Rückweg holt er sich einen Plattfuß, der Bauernjunge trägt das Fahrrad auf den Schultern nachhause und kommt erst im Morgengrauen zurück. Sein Onkel wird ihn deshalb wenig später mit schmerzhaften Gürtelhieben bestrafen. Foggia bleibt vorerst ein unerreichbarer Traum.

Nonno Ciccio unterwegs. (Foto: Max Intrisano)
Bis heute haben die Fahrten Malgieris ihren heroisch-unvernünftigen Charakter beibehalten. Am Abend vor dem Spiel ruft er auf seinem kleinen Selbstversorger-Bauernhof bei Foggia mit einem perfekt imitierten Blöken seine 21 Schafe und 16 Ziegen in den Stall. Dann bereitet er Pastasciutta für den Spieltag vor. „Exakt 133 Gramm Maccheroni, 100 für mich, 33 für den Herrgott, aufs Gramm genau“, erzählt er. Nonno Ciccio bekreuzigt sich, gibt üppig Tomatensauce bei und verpackt die Nudeln in einer Frischhaltedose.
Zum Trinken stellt er eine Flasche Leitungswasser bereit. Seit er in der Wüste beinahe verdurstete, trinkt er nur noch Wasser. Keinen Alkohol, keinen Kaffee, keinen Zucker, er raucht nicht und war angeblich noch nie in seinem Leben in einer Bar. „Da lungern nur Nichtstuer und Besoffene herum.“ Außerdem ist dem Pensionär ein Euro für eine Flasche Wasser zu teuer. Nonno Ciccio betreibt Askese, um autonom zu bleiben.
„Dank Foggia habe ich Italien kennen gelernt“
Er mag es, alleine zu sein. Landluft atmen, wenig mit anderen zu tun zu haben, sein Sohn hilft ihm auf dem Bauernhof. „Wenn ich alleine bin, muss ich mich auch nicht ärgern“, sagt er. Im Morgengrauen setzt er sich in sein Auto, unangeschnallt, und fährt los. Ein hölzernes Kruzifix baumelt am Rückspiegel, den heiligen Antonio, Schutzpatron der Reisenden und der Unterdrückten, hat Malgieri am Armaturenbrett befestigt.
Fortan begleiten ihn nur noch die Hartnäckigkeit des bedingungslosen Tifoso und die blecherne Stimme eines Navigationsgeräts. „Dank Foggia habe ich Italien kennen gelernt“, sagt Nonno Ciccio. Als die Mannschaft zu Beginn der 90er Jahre unter dem legendären Trainer Zdeněk Zeman die Serie A mit spektakulärem Angriffsfußball aufmischte, besuchte er alle großen Stadien, in Mailand, Turin, Neapel oder Rom. Unterwegs schaut er aus dem Fenster und freut sich über die wechselnden Landschaften, die an ihm vorbei ziehen.

Nonno Ciccio im Stadion (Foto: Max Intrisano)
Sein Alltag ist die Provinz. Foggia stieg immer wieder auf und ab, ging bankrott und wurde neu gegründet. In der abgelaufenen Saison spielte die Mannschaft in der dritten Liga. Catania, Ischia, Catanzaro, Matera, Lecce waren Nonno Ciccios Ziele in der abgelaufenen Saison. Seit er 1964 das Team zum ersten Mal zu einem Auswärtsspiel begleitete, habe er keine Partie mehr verpasst, sagt Malgieri. Manchmal hört er Volksmusik im Auto, sizilianische Lieder, wenn es nach Sizilien geht, kampanische Musik, wenn er in die Gegend von Neapel reist. Nonno Ciccio hat auf diese Art die lokalen Dialekte perfektioniert, für den Notfall. Wenn Anhänger des Auswärtsteams aus Sicherheitsgründen nicht im Stadion zugelassen sind, dann hilft er sich mit dem Dialekt aus den Liedern. Er hat sich auch schon als geisteskrank oder Obdachloser ausgegeben, nur um ins Stadion zu kommen. „Ultrà sein, bedeutet nie den Mut zu verlieren und jede Anstrengung in Kauf zu nehmen“, sagt er.
Camouflage und Mimikry sind für den greisen Schlachtenbummler eine Frage des Überlebens. Als der 17-Jährige im Oktober 1942 von britischen Soldaten in einem Schützengraben in El Alamein eingekesselt wurde, zog er eine britische Flagge aus der Unterhose, die er zuvor einem gegnerischen Soldaten abgenommen hatte und ergab sich.

Nonno Ciccio als Soldat.
Die Briten töteten ihn nicht, er kam als Kriegsgefangener nach Sri Lanka und später nach Glasgow, bevor er 1945 nachhause zurückkehrte. Was er in Nordafrika erlebt hat, lässt ihn immer noch nicht los. Vom Whiskey betäubte Engländer, die blindwütig um sich schossen. Junge Deutsche und Italiener, die wie Maschinen töteten, um nicht selbst zerfetzt zu werden. Seine Stimme zittert, wenn er von El Alamein erzählt. Vom höllischen Artilleriefeuer, von unzähligen britischen Panzern, die seine Kompanie umzingelten, vom vielen Blut. „Ich will mich nicht an meine Jugend erinnern“, fleht er. „Wenn ich an meine Jungs denke, die jungen Ultràs von heute, die Krieg wollen, dann ist mir zum Heulen zu Mute.“ Nonno Ciccio will Frieden. Er versucht zu schlichten, wo Randale in der Luft liegen. Vor jedem Spiel schüttelt er den Polizisten vor dem Stadion die Hand.
Im Gepäck hat er stets ein Transparent dabei. „Frieden zwischen Ultràs“, steht darauf, es ist der Kontrapunkt zur oft gewalttätigen italienischen Fan-Kultur. Auch an diesem Abend, beim entscheidenden Halbfinal-Playoff zum Aufstieg in die Serie B trägt er es sorgsam aufgerollt unter dem Arm. Die harten Jungs im Pino-Zaccheria-Stadion von Foggia wollen dieses Transparent bei Heimspielen nicht in der Kurve, es steht in ihren Augen für eine lächerliche Botschaft. Nonno Ciccio hängt es am Geländer auf der Gegengeraden auf, hier ist sein Stammplatz, für den ihm der Verein eine lebenslange Dauerkarte geschenkt hat. „Ciao Nonnoooo!“ rufen die Tifosi.
Hier ein Schulterklopfen, da ein Selfie, ein Fan, dessen Großvater schon mit Nonno Ciccio ins Stadion ging, küsst ihn auf den Mund. Nonno Ciccio ist eine Berühmtheit in Foggia. „Sie sind ein Vorbild, ein Symbol“, sagt ein anderer. Dass er Inhaber der Tessera del Tifoso ist, des bei den Ultràs verhassten Fanausweises, der Voraussetzung zum Eintritt bei Auswärtsspielen ist, wird toleriert. „Ich bin der einzige mit Tessera, den sie lieben“, sagt Malgieri. Sie lieben ihn wirklich, aber nicht alle nehmen ihn ernst.

„Sie sind ein Vorbild, ein Symbol!“ (Foto: Max Intrisano)
Als das Stadion sich gefüllt hat, humpelt der Alte vor die Kurve und lässt sich von den Ultràs bejubeln. „Nonno Ciccio, einer von uns“, grölen die einen. Andere besingen sein angeblich formidables Geschlechtsteil und der Greis weiß nicht, ob er lächeln oder den Kopf schütteln soll. Das Spiel hat begonnen. Knapp 20 000 Zuschauer sind gekommen, die Atmosphäre ist überschäumend. Nonno Ciccio lehnt auf Höhe der Mittellinie am Geländer, das Spiel gegen US Lecce verfolgt er beinahe stumm und bewegungslos mit der rechten Hand vor dem Mund. Einmal spuckt er aus, in sein Stofftaschentuch.
Dann geht Foggia mit einem fulminanten Weitschuss in den Winkel mit 1:0 in Führung. Der Alte reißt seine Veteranenmütze vom Kopf und schwenkt seine Fahne, um gleich darauf wieder zu erstarren. Nach dem 2:0 bietet er im allgemeinen Delirium dasselbe wohltemperierte Spektakel. Dann pfeift der Schiedsrichter ab. Foggia steht im Finale um den Aufstieg in die Serie B, der AC Pisa ist der Endspielgegner. Während sich alle in den Armen liegen, ist Nonno Ciccio schon längst wieder unterwegs. „Auf geht’s nach Pisa“, sagt er.

Nonno Ciccio feiert. (Foto: Max Intrisano)