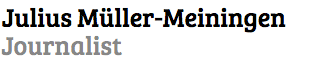Es gibt zwei Möglichkeiten, die katholische Kirche zu verändern. Die eine ist, aus der Zeit gefallene Regeln und Bräuche im Hauruckverfahren aufzuheben. Die wahrscheinliche Konsequenz wäre ein Schisma, die Abspaltung desjenigen Teils des Klerus, der diese Neuordnung nicht will. Die andere Möglichkeit ist, Prozesse in Gang zu bringen, die letztendlich zum selben Ergebnis führen, aber die katholische Kirche im Wesentlichen zusammen halten. Diesen Prozess hat Papst Franziskus in den vergangenen Jahren gewählt. Am 13. März ist er fünf Jahre im Amt.
Wirklich greifbare Ergebnisse vorzuweisen hat der Papst kaum. Bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch ist Franziskus nicht konsequent, die Kurienreform gleicht fünf Jahre nach ihrem Beginn oft immer noch einem Brainstorming, die Vatikanfinanzen hat der Papst bis heute nicht im Griff. Dazu kommen persönliche Widersprüche, die aber auch mit den Erwartungen der Öffentlichkeit zu tun haben. Sie will im lustigen Jorge Bergoglio vor allem einen milden Hirten erkennen, der im Umgang mit seinem Apparat von brutaler Autorität sein kann. Dieser Aspekt passt nicht in das Bild, das sich die meisten Menschen vom Papst gemacht haben.
Sein offener Blick auf Armut, Umwelt, aber auch auf die Ökumene hat Maßstäbe gesetzt, die aber für seinen Nachfolger keine bindende Wirkung haben. Schwieriger wird es eines Tages sein, sich nach dem Pauperismus Bergoglios wieder in päpstlichem Prunk oder in einer Limousine zu zeigen. Die Weichenstellung mit den unmittelbarsten Folgen ist die Auswahl, die Franziskus bei der Nominierung neuer Kardinäle getroffen hat. Nicht arrivierte Theologen sind aus seiner Sicht zur Leitung der Kirche geeignet, sondern Männer, die an aus europäischer Sicht vergessenen Orten der Welt ihre Mission erfüllen. Diese Politik wird die Kirche nachhaltig prägen, die Zusammensetzung des Kardinalskollegiums macht die Wahl eines Nachfolgers aus der westlichen Hemisphäre immer unwahrscheinlicher.
Die noch kaum sichtbaren, aber folgenreichsten Veränderungen hat der Jesuit Jorge Bergoglio bewirkt, indem er sich beim Gründer seines Ordens, Ignatius von Loyola, orientiert hat. Franziskus hat das spirituell-ignatianische Prinzip der „Unterscheidung der Geister“ als allgemeinen Maßstab in der Weltkirche eingeführt. Dabei geht es im persönlichen Bereich um die aufmerksame Interpretation der Wirklichkeit. Als allgemeiner Maßstab hat die Unterscheidung zur Folge, dass von pauschal geltenden Gesetzen, wenn notwendig, Ausnahmen in der Praxis gemacht werden können.
Während bis zur Wahl des ehemaligen Erzbischofs von Buenos Aires am 13. März 2013 in der Kirche doktrinelle Klarheit herrschte, breitet sich seither ein Element mit revolutionärem Potential in der katholischen Kirche aus. Das Geschick Bergoglios besteht darin, scheinbar keine Entscheidungen von oben herab zu fällen, sondern die Kirche diesen Weg selbst gehen zu lassen. An zwei Beispielen ist dieses Vorgehen besonders gut zu beobachten. Der eine Prozess ist bereits abgeschlossen und betrifft die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener in Einzelfällen zu den Sakramenten, der andere ist der Angriff auf den Zölibat.
Der erste Teil des Pontifikats war geprägt vom sperrigen Thema der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten, ein Thema mit Umsturzpotential. Das zeigten die heftigen, aber letztlich ergebnislosen Proteste des ultrakonservativen Flügels der Kirche. Die Entscheidung, die Gläubigen per Fragebogen an einer Diskussion teilnehmen zu lassen, die dann auf zwei Synoden verbittert geführt wurde und im Frühjahr 2016 in das päpstliche Schreiben Amoris Laetitia mündete, war die eines gewieften Taktikers. Der seit Beginn des Pontifikats erklingende Ruf nach mehr Barmherzigkeit untermalte diesen Generalplan zu einem lockeren Umgang mit der Doktrin. Seit Amoris Laetitia sind Katholiken aufgefordert, mithilfe des Kriteriums der Unterscheidung ihrem Gewissen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die absolute moralische Norm (keine Kommunion für diejenigen, die laut traditionellem katholischem Verständnis Ehebruch begangen haben) muss nicht mehr in jedem Fall absolute Geltung haben.
Der Trick des Papstes bestand darin, sich dieses Ergebnis durch die Diskussionsergebnisse der Bischöfe auf den Synoden auf dem Silbertablett präsentieren zu lassen. Damit sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Denn das Prinzip, die Norm im konkreten Fall auch mal Norm sein zu lassen, ist auf verschiedene umstrittene Bereiche anzuwenden. Der Umgang der Kirche mit Homosexuellen könnte sich auf diese Weise ändern. Statt pauschaler Ablehnung ist mithilfe des Kriteriums der Unterscheidung ein differenzierter Blick auf schwule oder lesbische Paare möglich. Dasselbe gilt bei der Frage der Verhütung oder sogar bei der Frauenweihe. Franziskus lässt bekanntlich eine Kommission beraten, die sich der Frage und der Geschichte des weiblichen Diakonats widmet.
Schon jetzt zeichnet sich das beherrschende Thema des zweiten Teils des Pontifikats ab, es ist die Frage der Weihe verheirateter Männer. „Wir müssen darüber nachdenken, ob Viri probati eine Möglichkeit sind“, sagte Franziskus im Interview mit der ZEIT bereits vor etwa einem Jahr und nahm damit die Diskussion über den Einsatz solcher „bewährter Männer“ vorweg. Diese Viri probati sind zwar verheiratet, können aber aufgrund ihrer aus katholischer Sicht vorbildlichen Lebensführung dennoch zu Diakonen geweiht werden. Kritiker befürchten zurecht: Wenn einmal die Weihe bewährter Männer legalisiert wird, ist es bis zur Abschaffung des Pflichtzölibats auch nicht mehr weit.
Die Planungen dazu sind nicht etwa vage, sondern folgen einem konkreten Zeitplan. Kürzlich wurden aus dem Vatikan wieder einmal Fragebögen an die Diözesen versendet, damit die Betroffenen vor der Jugend-Synode in diesem Herbst ihre Meinung kundtun können. Auf der Synode sollen die Bischöfe unter anderem auch über das Thema Berufung debattieren, also über die Frage, unter welchen Bedingungen man sich in den Dienst der Kirche stellen kann. Dazu zählt auch die Frage, ob man für den Weihedienst verheiratet oder ledig sein muss.
Die Kerndebatte zum Thema könnte dann ein Jahr später bei der Amazonas-Synode im Vatikan geführt werden. Eines der großen Themen unter den im Amazonasgebiet aktiven Bischöfen ist die Frage, wie den dort verstreut lebenden Katholiken trotz Priestermangels der regelmäßige Zugang zur Eucharistie gesichert werden kann. Wegen der Weitläufigkeit des Gebiets können Katholiken im Amazonas oft nur alle paar Monate die Messe feiern. „Eine Kirche ohne Eucharistie hat keine Kraft“, sagt Franziskus. Der entlegene Amazonas könnte zum Testgebiet für die gesamte Kirche werden. Das entsprechende Kriterium für die Weihe von Viri probati in der Diaspora ist dabei schon zur Hand, es lautet „Unterscheidung“.
Dass die Weihe von Viri probati die Antwort auf das Problem sein wird, legen nicht nur die Worte des Papstes nahe, sondern auch Äußerungen einiger seiner engsten Vertrauten. Beniamino Kardinal Stella, Präfekt der vatikanischen Kleruskongregation, die über die den Klerus betreffenden Regeln wacht, hat die Weihe bewährter Männer kürzlich als Hypothese bezeichnet, die „aufmerksam zu bewerten ist, durchaus offen und ohne Engstirnigkeit“.
Dass der Angriff auf den Zölibat schon eine ganze Weile auf der Agenda Bergoglios steht, legt eine andere Personalie nahe. Claudio Kardinal Hummes, den Papst Benedikt XVI. kurzzeitig zum Präfekten der Kleruskongregation gemacht hatte, zeigte sich schon vor seinem Amtsantritt im Jahr 2006 kritisch gegenüber dem Zölibat. Weil Hummes mit dem Vorschlag damals an ein Tabu gerührt hatte, musste er öffentlich zurück rudern. Heute ist Hummes Vorsitzender des Amazonas-Netzwerks Repam der brasilianischen Bischofskonferenz, er gilt als Ideengeber der Amazonassynode, einer der engsten Ratgeber des Papstes und Befürworter der Weihe von Viri probati. Im Konklave 2013, so hat es Franziskus kurz nach Amtsantritt erzählt, saß sein Freund Claudio Hummes neben ihm und mahnte Bergoglio unmittelbar nach der Wahl, er dürfe als Papst die Armen nicht vergessen. So sei der Name Franziskus zustande gekommen, in Erinnerung an den Heiligen aus Assisi. Hummes war es auch, den der frisch gewählte Papst aus Argentinien bei seinem erste Segen Urbi et Orbi neben sich ganz vorne und auffällig gut sichtbar auf die Benediktionsloggia des Petersdoms schob. Wer wollte, konnte bereits in den ersten Momenten des Pontifikats eine Weichenstellung erkennen, die nun Wirklichkeit wird.