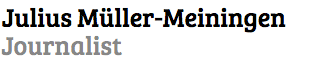In einer Welt, in der fast alles möglich scheint, hatten Katholiken eine Gewissheit, auf die Gläubige anderer Religionen verzichten mussten. Der Papst gab den Kurs vor, auch wenn das manchmal unangenehme Folgen hatte. Man konnte diesem Autoritarismus Folge leisten, sich an ihm reiben oder ihn ignorieren. Das Papsttum blieb trotz aller Orkanböen der Moderne eine letzte Instanz für Katholiken, ein polarisierender Anker im Ozean der Beliebigkeiten. Jetzt ist es plötzlich andersherum: Der Papst selbst bringt alte Gewissheiten in Bewegung. Der Anker, der bislang dogmatische Sicherheit und eine gewisse katholische Bequemlichkeit gewährleistete, hat sich gelöst.
Für die katholische Kirche ist das ein entscheidender Paradigmenwechsel. Papst Franziskus ist in seinem fünften Amtsjahr und rüttelt unverzagt an den Dogmen des Katholizismus. In der bislang hermetischen Ehe- und Sexualmoral der Kirche lässt er Ausnahmen zu, die für Kritiker dem Anfang vom Ende gleichkommen. Der Papst versucht, den lokalen Kirchen vor Ort mehr Autorität zu verleihen, etwa in Fragen der Liturgie oder der Gerichtsbarkeit. Das entspricht seiner Idealvorstellung einer Kirche, die nicht nur von oben herab angeleitet wird, sondern sich gemeinsam fortbewegt. Die Idee einer synodalen Kirche ist uralt, erst jetzt holt sie Franziskus sehr mühsam wieder aus der katholischen Mottenkiste.
Viele Katholiken sind angesichts der Veränderungen verstört. Manche behaupten, der Papst bereite den Weg für das Ende der katholischen Kirche. Das ist richtig, wenn man dieses Urteil auf ihre gegenwärtige Form bezieht. Wenn Franziskus könnte, würde er tiefgreifendere Veränderungen vornehmen. Das würde seine Kirche aber derzeit nicht aushalten, ein Schisma wäre die Folge. Unverhohlen bezichtigen Priester, Theologen und Laien ihr Oberhaupt der Verbreitung von Irrlehren. Kardinäle zweifeln öffentlich am Lehramt des Papstes. Das gab es über Jahrhunderte nicht und zeigt, in welchem kritischen Zustand die katholische Kirche sich befindet.
Auf der anderen Seite gibt es Befürworter der neuen Freiheit, die den Papst öffentlich gegen seine Gegner verteidigen. Die katholische Kirche durchlebt eine Identitätskrise, in der die grundverschiedenen Überzeugungen über das an die Oberfläche gelangen, was Katholischsein im 21. Jahrhundert bedeuten soll. Wieviel Wirklichkeit verträgt die Kirche, ohne eine beliebige christliche Religions- und Interessengemeinschaft zu werden, lautet dabei die Gretchenfrage.
Ob Franziskus seine Weichenstellungen auch über sein eigenes Pontifikat hinaus absichern kann, ist ungewiss. Die dogmatischen Öffnungen, etwa sein Zugehen auf wiederverheiratete Geschiedene könnte sein Nachfolger, wenn er wollte, wieder rückgängig machen. Hier hat Franziskus zaghaft und entschieden zugleich agiert. Zaghaft, weil er nicht zuviel Schaden anrichten wollte. Entschieden, weil er in der Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten eine Stellschraube erkannt hat, die systemverändernde Kraft hat. Das Gewissen, für Protestanten eine bekannte Größe, ist jetzt auch katholisch.
Allzu progressive Theologen könnten in Zukunft aber wieder von einer auf Linie getrimmten Glaubenskongregation zurecht gewiesen werden. Unter Franziskus herrscht weitgehend theologische Narrenfreiheit, kein katholischer Freidenker muss derzeit um seine Karriere fürchten. Stattdessen verlieren derzeit dogmatische Koryphäen wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller Ämter und Einfluss. Doch auch die mühsam voranschreitenden Reformen in der Kurie und bei den Vatikanfinanzen sind noch Stückwerk. Diese Richtungswechsel sind bislang Reformkosmetik, der Papst hat keine vollendeten Tatsachen geschaffen. Sein Spielraum ist durch die kräftige Opposition begrenzt.
Franziskus hat jedoch andere Keile eingetrieben, die den Kurs der Kirche nachhaltig prägen werden. Der bald 81-Jährige hat das Kardinalskollegium mit seinen bisherigen Ernennungen stark mitbestimmt. Das Gremium, aus dem eines Tages sein Nachfolger gewählt werden wird, besteht heute schon zu weiten Teilen aus Pastoren, wie der Papst sie sich wünscht: engagiert im Dialog und mit Blick für die Belange der Gläubigen. Vor allem aber hat Franziskus das Papsttum endgültig entzaubert. Bergoglio gibt sich als Pontifex zum Anfassen, der ein primus inter pares, aber kein Alleinherrscher mehr sein will. Das Zeitalter der Päpste, die sich auf die Anerkennung ihrer Autorität und Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen verlassen konnten, ist endgültig vorbei