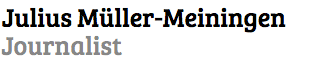Auch ich habe ein Pseudonym in dieser Stadt. Wenn ich mal wieder nach meinem für Italiener unaussprechlichen Namen gefragt werde, dann verwandle ich mich in Giulio Miuller. Miuller wie der Joghurt, sage ich dann. Die meisten Römer erwarten von einem Deutschen nicht so viel Witz, weshalb mir anschließend viele Türen offen stehen. Ob es Johann Philipp Möller damals ähnlich ging? Als solcher stellte sich einst bekanntlich Johann Wolfgang von Goethe vor, als er vor ziemlich genau 230 Jahren in Rom unterwegs war. Der Name Möller diente Goethe allerdings weniger als Türöffner, im Gegenteil. Der weit über Deutschland hinaus bekannte Dichter wollte sich auf diese Weise vor allem vor aufdringlichen Landsleuten schützen.
Es ist inzwischen 200 Jahre her, dass der erste Band seiner „Italienischen Reise“ erschien. Entstanden sind die für die Italiensehnsucht der Deutschen so wesentlichen Aufzeichnungen bereits dreißig Jahre früher. Schon vor seiner Ankunft konnte es Goethe kaum erwarten, Italien, aber eigentlich in erster Linie Rom zu betreten. „Ja, ich bin endlich in der Hauptstadt der Welt angelangt“, hält er am Tag seiner Ankunft, am ersten November 1786 fest.
Ich glaube, ich hatte bei meiner Ankunft ein ähnliches Gefühl, wie überhaupt die Stadt Rom ihre Bewohner dazu verleitet, die Realität aus einem verzerrten Blickwinkel wahrzunehmen. Nicht nur führen ja angeblich alle Wege hierher, die Stadt nimmt im Jahr auch etwa 15 Millionen Touristen auf, die alle kommen, um Jahrtausende alte Bauwerke einer untergegangenen, aber zweifellos großen Zivilisation zu bewundern. Die Römer sind sehr stolz auf diese Tatsache. Manche behaupten, dieses auf Ruinen errichtete und eine ungesunde Maßlosigkeit fördernde Selbstbewusstsein sei zum Beispiel der Grund dafür, dass die Stadt es einfach nicht fertig bringt, ihre vor zehn Jahren begonnene dritte U-Bahn-Linie fertigzustellen.
Goethe kam als Bildungsbürger nach Rom, als es diese Kategorie noch gar nicht gab. „Befleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahre alt werde“, schreibt er über seinen Plan, wie er die Stadt für sich zu erobern gedenkt. Ich werde auch bald 40. Als ich in dieser Stadt ankam, besuchte ich drei Museen und Kirchen am Tag, um mich bald doch der Selbstverständlichkeit der Existenz dieser Schätze hinzugeben.
Die meisten Römer nehmen diese Haltung unmittelbar nach ihrer Geburt an. Schließlich haben sie alles täglich vor der Nase, also können sie mit großer Gelassenheit an den Attraktionen vorbeifahren, die der Tourist im Schnelldurchlauf erobern muss. Es gibt viele Römer, die haben in ihrem Leben nie das Kolosseum oder die Sixtinische Kapelle betreten. Aber diese in aller Welt bewunderten Orte sind für sie eine stets greifbare Option. Das ist sehr angenehm, man muss für dieses Gefühl nämlich nirgends anstehen.
Beruhigend finde ich auch die enthusiastische Feststellung Goethes in seinen ersten römischen Tagen, dass in dieser Stadt sogar „der gemeinste Mensch“ etwas werde. Ich kann das für meinen ursprünglich hoffnungslosen Fall durchaus bestätigen. Auch das Gefühl, „einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat“ erlebt zu haben, ist mir nicht ganz fremd. Während sich der bekannteste aller deutschen Dichter am Apollo von Belvedere nicht satt sehen konnte, haben auf mich bis heute die Köstlichkeiten der römischen Küche eine verheerende Wirkung. Eine in einer echten römischen Trattoria zubereitete Portion Spaghetti alla Carbonara macht mich glücklicher als die doch sehr starr dreinblickende Juno Ludovisi, an deren Anblick sich mein Landsmann labte.
Andere Dinge, die mich auch nach acht Jahren in dieser Stadt „aus der Wirklichkeit hinausrücken“ sind: Mit dem Mofa vom Gianicolo-Hügel in Richtung Trastevere hinunter fahren und auf die Stadt blicken. Ich mag die Selbstsicherheit der Römer, ihren lauten, manchmal derben Witz. Ich mag auch die immer irgendwie belebten Straßen und die Tatsache, dass man einen Verkehrsunfall auf einer sechsspurigen Straße mit schwerem Blechschaden laut schreiend im Weiterfahren regeln kann. Ich würde sogar wagen zu behaupten, diese Szene hörte sich für mich zu Kultursinn, Gründlichkeit und Ordnung erzogenen Jüngling wahrhaftig an „wie ein Gesang Homers“.
Mit großer Erleichterung habe ich festgestellt, dass sich auch Goethe in Rom zeitweilig aufgeführt hat wie jeder beliebige Rom-Tourist. Mindestens einmal betrank er sich in Trastevere, erst war er zwar nur „vom heiligen Kunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre“ beschwingt, aber dann eben doch auch vom süßen Wein. Auf dem Celio-Hügel beim Besuch der Ruinen der Domus Aurea steckte er sich die Taschen mit Scherben und Marmortäfelchen voll. Natürlich handelt es sich dabei um den untauglichen Versuch, die Ewigkeit mit nachhause zu nehmen.
Immerhin macht sich dieses gemäßigte Rowdytum wesentlich sympathischer aus als das Benehmen anderer europäischer Granden seiner Zeit. Napoleon ließ ganze Kunstwerke unentgeltlich in den Louvre nach Paris schaffen. König Ludwig I. von Bayern bezahlte immerhin für die Medusa Rondanini, von deren Todesblick Goethe sich sehr beeindruckt zeigte und die heute in der Glyptothek in München zu bewundern ist.
Längere Aufenthalte in Rom bringen es unweigerlich mit sich, dass die Begeisterung für die vertraute Fremde, für dieses „Auch ich in Arkadien!“ plötzlich umschlägt in Abneigung und Unverständnis. Goethe merkte das nach drei Monaten, als er den „ungeheuern und doch nur trümmerhaften Reichtum dieser Stadt“ erkannte. Auch der Umgang mit Touristen ließ damals schon zu wünschen übrig. „Jeder Führer hat Absichten, jeder will irgendeinen Handelsmann empfehlen, einen Künstler begünstigen, und warum sollte er es nicht?“, schreibt Goethe. Daran hat sich auch nach 230 Jahren im Wesentlichen nichts geändert.
Die dunkle Seite Roms liegt auch heute besonders gut sichtbar da. Ein „Mafia Capitale“ genanntes Netzwerk aus Verbrecherorganisationen und willfährigen Funktionären und Politikern teilte sich in den vergangenen Jahren die letzten noch abgreifbaren Mittel in der mit über zehn Milliarden Euro verschuldeten Stadt auf. Die Stadtverwaltung hat immer noch kein Konzept für eine funktionierende Müllentsorgung, der öffentliche Nahverkehr ist einer europäischen Hauptstadt unwürdig. Die seit bald einem halben Jahr amtierende Bürgermeisterin Virginia Raggi von der Protestpartei 5-Sterne-Bewegung tritt nach wie vor auf der Stelle. Manchmal finde auch ich Rom zum Haareraufen.
Die Römer seien „Naturmenschen“, die „unter Pracht und Würde der Religion und der Künste nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch sein würden“, stellte Goethe 1786 fest. Das kann ich bestätigen. Der allgemeine Verfall färbt sogar persönlich ab, mehr noch, der Höhlenmensch in mir wurde in den letzten Jahren durchaus stimuliert. Ich selbst, der früher ein diktatorisches Verständnis von Mülltrennung hatte, gehe dieser Pflicht in Rom nur noch mit Nachlässigkeit nach. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich sogar auch schon einmal ein Stück Papier zu Boden fallen lassen, ohne es wieder aufzuheben. Das ist eine Schande. Andererseits bedeutet es auch, dass ich nach vielen Jahren endlich in dieser Stadt angekommen bin.
Ganz ungefährlich ist es übrigens auch heute nicht in Rom. Aber angesichts der vier Totschläge, von denen Goethe in seinen ersten drei römischen Wochen in seinem Viertel, der Altstadt, berichtet, kann ich mich bislang in meiner Umgebung glücklich schätzen. In fünf Jahren erfuhr ich nur von einem Toten bei mir um die Ecke, der war allerdings in einen Plastiksack gewickelt und neben die Mülltonne gelegt worden. Sieht man einmal vom Verkehr und den Taschendieben in den Bussen zwischen Hauptbahnhof und Vatikan ab, halte ich Rom für eine nicht wirklich gefährliche Stadt.
Dringend abzuraten ist allerdings von Besuchen am östlichen Stadtrand in Ponte di Nona. Wegen der Aggressivität der dort herrschenden Drogenbanden warnen Einheimische sogar davor, mit dem Auto an der roten Ampel stehen zu bleiben. Die Konsequenzen könnten unangenehm sein.
In diesem Zusammenhang ist es nur allzu verständlich, dass Goethe es schließlich kaum erwarten konnte, dieser ebenso verkannten wie faszinierenden „Hauptstadt der Welt“ im Februar 1787 den Rücken zu kehren und per Postkutsche weiter nach Neapel, zum Vesuv und schließlich nach Sizilien zu eilen. Der Dichter wollte letztlich vor allem weg aus Rom. Ich kenne dieses Gefühl der notwendigen Flucht aus dem Moloch. Aber spätestens nach zwei Tagen in der Ferne und in Gedanken an die „Schönheit Roms im Mondschein“ überfällt mich ein ungemeines Heimweh. Und die Stadt hat mich wieder voll im Griff.