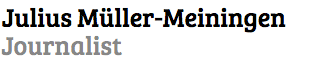In der Woche danach hat sich Mirko Graziano von der »Gazzetta dello Sport« Urlaub genommen und sein Telefon ausgeschaltet. Stefano Pasquino von »Tuttosport« ist drei Tage ans Meer gefahren, um sich zu erholen. Am Schlimmsten hat es Andrea Ramazzotti vom »Corriere dello Sport« erwischt. Er ist unmittelbar nach seiner Rückkehr vom Champions-League-Finale in Madrid ins Krankenhaus gegangen, weil es ihm »nicht so gut« gehe, wie er mit schwacher, fast versagender Stimme ins Handy haucht. Was genau es ist, weiß er auch nicht. Aber es wäre kein Wunder, wenn der Auslöser seiner Kreislaufprobleme José Mourinho hieße.
»Bitte erst in ein paar Tagen wieder melden!« Das ist die Standard-Antwort, mit der die Reporter von Italiens großen Sporttageszeitungen Fragen nach dem Gespenst abwehren, auf das sie in den vergangenen zwei Jahren Jagd gemacht haben. Oder war es der Trainer von Inter Mailand, der die italienischen Journalisten bis in ihre Träume verfolgt hat? Jedenfalls haben die Beteiligten ziemlich viele blaue Flecken aus ihrer zweijährigen Chaosbeziehung davon getragen. Es ist ein bisschen wie bei einem Wirbelsturm, der übers Land hinweg gezogen ist. Er hat alles durcheinandergebracht und war so schnell wieder vorbei, wie er aufgekommen ist. Jetzt rappeln sich die Geschundenen auf und begutachten den angerichteten Schaden.
Am Ende haute es sogar José Mourinho selbst um. Nachdem er im ersten Jahr bereits italienischer Meister wurde, gelang ihm in der zweiten Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Keiner in Italien hatte das bisher geschafft. Nach 45 Jahren brachte er Inter den Pokal der Landesmeister zurück. Bei der Siegerehrung im Madrider Bernabeu-Stadion am 22. Mai brach Mourinho an der Brust des Inter-Präsidenten Massimo Moratti in Tränen aus wie ein kleines Kind. Zärtlich strich der Präsident dem Trainer einige Male über den Kopf, um ihn zu trösten. Der stolze Mourinho wirkte auf einmal ganz klein und verletzlich.
Verrat an Inter Mailand
Der Moment bekam seine Dramatik vor allem aus dem Verrat, den Mourinho begangen hatte. Ohne wissen zu können, wie das Endspiel gegen den FC Bayern München ausgehen würde, hatte er sich für die kommende Saison Real Madrid als Trainer versprochen. Seit Monaten befeuerte er selbst die Gerüchte mit zweideutigen Aussagen und behauptete, er werde erst nach dem Finale entscheiden. Das war eine Lüge. Vielleicht wählte er deshalb für sein Geständnis nicht das italienische Fernsehen, sondern das deutsche. Verschämt nickte er auf die Frage des Sat.1-Moderators, ob das sein letztes Spiel auf der Bank von Inter Mailand gewesen sei. Es wirkte so, als ob der Betrüger den Betrogenen nicht in die Augen blicken konnte.
Später, in den Katakomben des Bernabeu-Stadions, setzte sich Mourinho in den Fond einer schwarzen Limousine. Der Wagen fuhr an, hielt aber nach ein paar Metern wieder. Der Trainer stieg aus und lief zu seinem Spieler Marco Materazzi, der melancholisch vor dem Mannschaftsbus an einer Mauer lehnte und auf die Abfahrt wartete. Mourinho fiel Materazzi um den Hals, wieder zuckte sein Oberkörper unter Weinkrämpfen. Erst klopfte der große Abwehrspieler mit den reichlich tätowierten Unterarmen seinem Trainer auf die Schultern. Dann kamen auch ihm die Tränen. Es ist das letzte Bild, das viele in Italien von Mourinho in Erinnerung haben.
In der Mailänder »Gazzetta dello Sport« wurde die theaterreife Abschiedsszene in der Folgezeit rauf und runter analysiert. Am Ende waren dem Autor aber nicht die vergossenen Männertränen wichtig, sondern die Tatsache, dass es sich bei der Limousine, in der der Coach davonfuhr, um einen Dienstwagen von Real Madrid handelte. Ein Abgang an Bord der Konkurrenz. »Das ist wie der Abschied vom alten Partner in Begleitung des neuen«, schrieb der stellvertretende Chefredakteur Franco Arturi beleidigt. José Mourinhos letzter Auftritt nach zwei Jahren Mailand wird als sein letzter Affront in Erinnerung bleiben.
So hohe Auflagen wie noch nie
Der »Magier Mou«, wie die »Gazzetta« noch am Tag des Finales getitelt hatte, bewies auch beim Abschied Taktlosigkeit. Erfolg, Emotionen, Tränen, Konflikt und Verrat. Diese Mischung hat Italiens meistgelesener Zeitung in der vergangenen Saison fast vier Millionen Leser täglich beschert, so viele wie noch nie. »Es gibt keinen Trainer, der die Zeitungsseiten gefüllt hat wie er«, sagt Alberto Polverosi vom Konkurrenzblatt. Er ist Chef der Mailänder Redaktion des »Corriere dello Sport«.
Im Vergleich zu seinen Kollegen hat der 51-Jährige noch viel Energie, wenn man bei ihm die Mourinho-Taste drückt. Dann rasen die letzten zwei Jahre wie im Zeitraffer vorbei: José Mourinhos erste Pressekonferenz im Juni 2008, als er die Berichterstatter mit nahezu perfektem Italienisch und Kenntnissen im Mailänder Dialekt überraschte. »Wir rieben uns alle die Augen«, erzählt Polverosi. Wie er die Mannschaft von Inter Mailand zu einer Einheit formte, »die durchs Feuer für ihn gegangen wäre«. Polverosi meint das wörtlich.
Immer wieder fällt der Ausdruck vom »großen Kommunikator«. Es ist der gebräuchlichste Gemeinplatz über den 47-jährigen Portugiesen, aber auch der wahrste. Es ist der springende Punkt zwischen José Mourinho und der Presse. »Wenn du ihm eine banale Frage stellst, bekommst du bei ihm mindestens eine interessante Antwort«, sagt Polverosi. Keiner versteht es wie Mourinho, den Diskurs in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken.
Truppe von Muskelprotzen
Es heißt immer, der Trainer nehme so Druck von seiner Mannschaft und würde von ihren Schwächen ablenken. Das Problem wurde bald, dass die Reporter Mourinhos größte Stärke als seine größte Schwäche auslegten.
Polverosi behauptet, was alle seine Kollegen bestätigen: »Mourinho war nicht vorbereitet auf die italienische Presse, die besonders an Fragen zu Taktik und Spielsystemen interessiert ist. Dazu haben wir von ihm fast nie eine befriedigende Antwort bekommen.« Auch nicht auf dem Platz. Vor allem in der ersten Saison erlebten die Reporter Inter als eine Truppe von Muskelprotzen, die die Bälle nach vorne droschen, wo dann Zlatan Ibrahimovic stand, dem meistens etwas Sinnvolles mit dem Ball einfiel.
Nachdem der Schwede zum FC Barcelona verkauft worden war, wurde Inter immer besser. Aber manche halten es auch heute noch für Hochverrat, dass Mourinho einen eleganten Stürmer wie Samuel Eto‘o am eigenen Strafraum Bälle wegschlagen lässt.
Hinter dem Macho José Mourinho versteckt sich ein Trainer, der Angst vor Gegentoren hat. Er tut alles dafür, sie nicht zu bekommen. Der italienische Fußball ist ein von Skandalen und Gewaltausbrüchen verunsichertes System, das immer weiter hinter die Konkurrenz zurückfällt. Beide sind sehr empfindlich, beide halten sich für den Nabel der Welt.
Sehnsucht nach schönem Fußball
In Italien, dem Land, in dem der defensive catenaccio weltberühmt wurde, ist die Sehnsucht nach schönem Fußball groß. Und Mourinho glänzte darin, dass er mit Italiens meistgehasster Fußballmannschaft den hässlichen calcio all’italiana perfektionierte. Dem Erfolgsdruck bei Inter Mailand war das angemessen. Den Ansprüchen seiner Kritiker nicht. Der Wurm war bald auch deshalb drin, weil hier einer dem anderen den Spiegel mit einer besonders hässlichen Fratze vors Gesicht hielt.
Dazu kommt, dass Italiens Sportpresse ein ähnlich ausgereiftes Selbstbewusstsein wie Mourinho hat und es guten Trainern kleinerer Teams immer wieder gelang, Inter mit taktischen Kniffen in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. »Was Spielkultur und Taktik angeht, kann er vielen italienischen Trainern nicht das Wasser reichen«, behauptet Polverosi. Das ist etwas, was man José Mourinho nicht spüren lassen sollte, will man keinen Wirbelsturm entfachen.
Mourinho verstand, welchen Eindruck sich die Leute von ihm machten, die nicht zur Inter-Gemeinde gehörten. »Er wäre ideal als Vorstand eines Vereins, eines Reiseunternehmens, eines Verlages, einer der die großen Linien zeichnet und dem dann alle nachlaufen.« Polverosi sagt das über den Mann, der sich für den besten Fußballtrainer der Welt hält und der seine Überheblichkeit auf zwei portugiesische, zwei englische, zwei italienische Meistertitel, einen UEFA-Cup-Gewinn und zwei Erfolge in der Champions League stützen kann.
Toller Zirkusdirektor, kein so guter Trainer
Etwas verkürzt formuliert, hielten die meisten Mourinho für einen ausgezeichneten Zirkusdirektor, aber nicht für einen großartigen Trainer. Es ist umgekehrt genau das, was Mourinho von den Journalisten denkt: Sie sind für ihn Schaumschläger, die ihn vor und vor allem nach den Spielen stundenlang mit provokativen Fragen bedrängen, aber aus seiner Sicht nichts von Fußball verstehen. Ein Kollege meint, über Mourinho zu berichten sei manchmal, wie eine Theaterkritik zu schreiben. Das sind Beleidigungen, die einer wie Mourinho nicht aushalten kann. Also schlug er zurück.
Manchmal erinnerte das Verhältnis von José Mourinho und Italiens Journalisten an ehrgeizige Jungs auf dem Bolzplatz. Sie provozieren und kränken sich gegenseitig. Am Ende gibt es eine große Keilerei, und einer muss das Feld räumen. Die anderen bleiben verletzt zurück.
Andrea Ramazzotti hat eine ziemlich tiefe Wunde davongetragen, vielleicht auch, weil er bei einem Hahnenkampf Federn gelassen hat, an dem er überhaupt nicht teilnehmen wollte. Der 35-jährige Reporter des »Corriere dello Sport« ist ein freundlicher und ruhiger Typ. Aber an einem Dezemberabend 2009 entlud sich Mourinhos ganzer Frust an ihm.
Inter hatte bei Atalanta Bergamo nur 1:1 gespielt. Bevor die Mannschaft nach dem Spiel mit dem Bus abfuhr, stellte sich Ramazzotti zu den Kollegen von »Inter-Channel«, die vor dem Einsteigen die Stimmen der Spieler exklusiv sammeln dürfen. In Absprache mit der Pressestelle des Vereins schreibt nach jedem Spiel einer der Zeitungsjournalisten die Kommentare mit und gibt sie an die Kollegen weiter. An diesem Sonntag war Ramazzotti dran. Mourinho saß bereits vorne im Bus und beobachtete die Szene. Als er den Reporter sah, stürzte er herbei und brüllte: »Was zum Teufel macht dieser Hurensohn hier?« Er packte Ramazzotti am Kragen, drängte ihn vom Bus weg. »Mister, ich habe Sie nie beleidigt«, entgegnete der Journalist verstört. »Hau ab, du Hurensohn«, rief ihm der Trainer nach.
Hassliebe und Hurensöhne
Es war der Tiefpunkt, von dem sich das Verhältnis zwischen Mourinho und der Presse nicht mehr erholen sollte. Als »Hassliebe« bezeichnet Ramazzotti heute das Verhältnis zu Mourinho. Dabei hätte er eigentlich genügend Gründe, den zweiten Teil des Wortes wegzulassen. Über die Episode will er nicht mehr sprechen, aber Kollegen erzählen, wie getroffen er war. Die Reporter empfanden den Vorfall als Affront gegenüber der gesamten Branche. Nicht einmal danach stieg Mourinho, der mit einer Geldstrafe belegt wurde, von seinem hohen Ross. Bei der nächsten Pressekonferenz gab er an, dass er nur seine Mannschaft gegen die Aufdringlichkeit der Journalisten habe schützen wollen. Anschließend witzelte er, dass er von dem Reporter ein Weihnachtsgeschenk erwarte, weil der es nur ihm zu verdanken habe, dass der berühmteste Ramazzotti nun mit Vornamen Andrea und nicht mehr Eros heiße. Der Gag kam nicht so gut an.
Auch persönlich hat sich Mourinho nie bei Ramazzotti entschuldigt. Stattdessen schoss er sich immer mehr auf Italien ein. Systematisch schottete er sein Team vor der Öffentlichkeit ab. Journalisten durften nicht mehr mit der Mannschaft reisen. »Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist«, sagte Inter-Präsident Massimo Moratti beklommen.
Im Februar wurde Mourinho für drei Spiele gesperrt und musste 40 000 Euro Strafe zahlen, weil er während der Partie gegen Sampdoria Genua seine Hände wie mit Handschellen gefesselt in die Kamera hielt. »Nehmt den Schiri fest!«, sollte die Geste bedeuten. Der große Kommunikator schoss weiter über das Ziel hinaus, seine Ausfälle wurden immer heftiger. Er war jetzt nicht mehr nur der Angeber, der auf Pressekonferenzen mit seinen angeblich 14 Millionen Euro Jahresverdienst prahlte. Mourinho bezeichnete Journalisten, die unangenehme Fragen stellen, als »frustriert« und bezichtigte den italienischen Fußballbetrieb der »intellektuellen Prostitution«.
Mourinhos Sprachlosigkeit
Das klang kompliziert, und während die Italiener sich den Kopf zerbrachen, was das Trainerorakel damit wohl gemeint haben dürfte, büßte Inter einen 15-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger AS Rom ein, der für ein paar Spieltage sogar die Tabellenführung der Serie A übernahm. Als es richtig eng wurde, hörte der vorlauteste Übungsleiter der Welt sogar ganz auf zu reden. Nur noch anlässlich der Champions-League-Spiele erschien er zu den Pressekonferenzen. Ende März gab er einem englischen Fernsehsender ein Interview und sagte: »Ich mag den italienischen Fußball nicht. Und er mag mich nicht.«
Einen Monat später, nach dem Halbfinal-Rückspiel beim FC Barcelona und dem Einzug ins Finale der Champions League, fragte »Tuttosport«-Reporter Stefano Pasquino den Trainer, was ihm denn die Klubweltmeisterschaft bedeute, die er im Fall des Finalsiegs mit Inter hätte spielen können. »Nichts«, sagte José Mourinho stimmlos. »Gar nichts.« Da hatten sie verstanden, dass er Italien verlassen würde.
Nun ist Mourinho weg und hat eine große Lücke hinterlassen. Inter Mailand musste einen neuen Trainer suchen, was Präsident Moratti ziemlich nervt, wie er bekannt hat. Die Lücke, die eigentlich ein großes Loch ist, kommt daher, dass Inter mit Mourinhos Abgang auch die eigene Identität eingebüßt hat. Die Spezialität des Trainers ist es, außen Abscheu zu erzeugen und diese dann in Kraft für seine Mannschaft umzuwandeln. Immer noch ist Inter unbeliebt, aber das Team droht auseinanderzufallen. Kurz nach dem Schlusspfiff in Madrid sagte Diego Milito, er habe Angebote und könne nichts über seine Zukunft sagen. Ein paar Tage später begann Maicon, öffentlich für Real Madrid zu schwärmen. Und Marco Materazzi schluchzte beim letzten Schulterklopfer mit dem Mister: »Und ich, hör‘ ich jetzt auf?«
Die Leere danach
Inter Mailand war in den vergangenen zwei Jahren José Mourinho. Deswegen ist es eher ein frommer Wunsch, wenn der immer noch etwas erschöpft wirkende Andrea Ramazzotti meint, seine Arbeit sei auch im kommenden Jahr dieselbe. Stefano Pasquino, der inzwischen von seinem Kurzurlaub am Meer zurück ist, verspürt sogar »eine Leere«. Er ist sich sicher, dass sich die Leute in 50 Jahren nicht an die beiden Milito-Tore im Finale gegen den FC Bayern München erinnern, sondern an José Mourinho, den Popstar, die Inter-Legende.
Die Bilder dazu hat Mourinho selbst geschaffen. Als er nach dem Finaleinzug mit wahnsinnigem Blick, erst einem und dann zwei in den Himmel gestreckten Zeigefingern über den Rasen in Barcelona rannte, bis die Hausherren den Rasensprenger anwarfen. Oder im Mai, als Inter die Meisterschaft doch noch knapp gewonnen hatte. Die Spieler hüpften in Siena auf dem Feld herum. Mourinho verzog sich mit dunkler Miene allein in den Mannschaftsbus, wartete vorne rechts auf seinem Platz und legte die Beine hoch. Damit die Welt diesen so heroischen wie exzentrischen Moment auch mitbekam, ließ er sich vom Staatsfernsehen interviewen. Auf einmal war wieder Platz für einen Reporter im Mannschaftsbus.
»Mir fehlt er jetzt schon«, sagt Mario Sconcerti. Der bekannte Kolumnist und Fernsehkommentator war lange das Epizentrum der italienischen Mourinho-Kritik. Bei einer Live-Schalte im November 2008 hatte der Inter-Trainer Sconcerti mit schneidendem Ton ins Gesicht gesagt, dass er auf keinen Fall mit ihm zum Abendessen gehen würde, auch wenn er ihn darum gebeten hätte. Sconcerti hatte eigentlich gar nicht an ein Candle-Light-Dinner mit Mourinho gedacht, sondern nur die Empfindlichkeit des Trainers auf die Probe gestellt, indem er es wagte, ihn kritisch mit seinem Vorgänger Roberto Mancini zu vergleichen. Seither galten die beiden als Antipoden.
Wie ein seltenes Tier
Heute spricht Sconcerti so behutsam über Mourinho wie über ein seltenes Tier. Er sei inzwischen sein Bewunderer und hoffe, dass wenigstens Mourinhos Detailversessenheit bleibe. Er sagt das in fast zärtlichem Ton. »Wir nehmen den Fußball viel zu ernst. José Mourinho hat unsere Schwachpunkte offengelegt.« Sconcerti hätte allerdings auch sagen können: »José Mourinho nimmt den Fußball viel zu ernst. Wir haben seine Schwachpunkte offengelegt.«
In der »Gazzetta dello Sport« taucht Mourinho immer noch auf. Die Stücke über den Verflossenen sind kleiner geworden, aber jeden Tag gibt es eine kleine Zuckung. In einem der letzten Beiträge stand, dass Javier Zanetti dem Trainer nach dem Champions-League-Finale seine gelbe Kapitänsbinde überreicht habe, in die er schon vor dem Spiel eine Widmung geschrieben hatte: »Bruder vieler Schlachten, zusammen sind wir Europas Champions geworden. Wir wollen mit dir weiterkämpfen.« Zanettis Hoffnung trog. Sein »Bruder vieler Schlachten« las die Botschaft wohl erst, als er in der Real-Limousine davon fuhr.