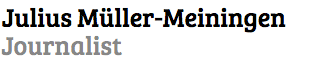Um zu verstehen, wie Mario Draghi tickt, muss man kein Volkswirt sein, geschweige denn Bankbilanzen lesen können. Es reicht eine Rückblende ins Jahr 2005, jenes Jahr, in dem Draghi als Gouverneur an die Spitze der Banca d’Italia rückte. Im Palazzo Koch, dem Sitz der italienischen Notenbank in der Via Nazionale in Rom, stand die Zeit, wie in den unzähligen anderen Adelspalästen der Stadt, in denen sich seit Jahrhunderten nichts verändert.
Mit Draghi zog die Moderne ein. Der Pomp und die Historie des Hauses interessierten den gebürtigen Römer nie. Sein Vorgänger hatte einen Kofferträger beschäftigt, Draghi entband ihn von seinen Aufgaben und trug seine Aktentasche selbst. Für sein Büro wählte er ein schlichtes, modernes Design, ein Gemälde mit den Leiden des heiligen Andreas musste weichen. Gemessen an der Schwerfälligkeit des italienischen Bankenadels sind solche Maßnahmen nichts anderes als Exorzismus. Aber Draghi hatte da erst begonnen.
Die größten Veränderungen musste der träge Organismus der Notenbank verdauen. Leitende Mitarbeiter bekamen Blackberrys, alle Computer erhielten einen Internetzugang. Noch heute halten die Mitarbeiter der Bank diesen, schon damals lange überfälligen Schritt für eine Revolution. Als Draghi für sich selbst einen Laptop forderte, stellte sich die Technikabteilung quer. Ein tragbarer Computer, wozu das denn? Der Gouverneur verlor nicht etwa die Fassung. Er rief seinen Sohn Giacomo an und trug ihm auf, einen Laptop für Papà zu besorgen.
Typisch Mario Draghi: Er sucht selten die direkte Konfrontation, sondern umgeht Hindernisse oder Kontrahenten, die sich ihm in den Weg stellen, lieber. Die anderen lässt er so einfach stehen. „Er ist ein Meister darin, Mehrheiten zu organisieren und gleichzeitig seine Gegner zu isolieren“, sagt ein Notenbanker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.
Vor zwei Jahren hat der 66 Jahre alte Draghi die Nachfolge des Franzosen Jean-Claude Trichet als Präsident der Europäischen Zentralbank angetreten. In der Krise um den Euro ist Draghi zum mächtigsten Mann Europas aufgestiegen, das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihn kürzlich auf Platz 9 der einflussreichsten Menschen der Welt gesetzt. Voraussichtlich ab Ende des kommenden Jahres übernimmt die EZB im Rahmen der Bankenunion auch noch die Aufsicht über Europas Großbanken. Draghis Stärke zeigt zugleich die Schwäche der europäischen Politiker.
Einzug der Moderne
Auch bei der EZB in Frankfurt ist mit Mario Draghi die Moderne eingezogen, in diesem Fall die geldpolitische. Durch entschlossenes Auftreten hat er in seiner noch relativ kurzen Amtszeit bereits zwei Mal verhindert, dass die Eurozone auseinanderbricht.
Es begann mit der „Dicken Bertha“. So hieß eigentlich die größte deutsche Kanone im Ersten Weltkrieg. Aber kurz nach Draghis Arbeitsbeginn im November 2011 war damit eine Billion Euro gemeint, die die EZB den europäischen Banken zur Verfügung stellte, Laufzeit drei Jahre, Zinssatz 1 Prozent. Die Banken sollten mit diesem Geld Staatsanleihen kaufen. Für die Geldhäuser ein lohnendes Geschäft, da sie die Zinsdifferenz zwischen dem billigen EZB-Geld und den Anleihen von Ländern wie Spanien und Italien, die damals an den Märkten 4 bis 5 Prozent Zinsen zahlen mussten, ohne großes Risiko für sich verbuchen konnten. Kurzfristig verhinderte Draghi damit, dass die Anleihezinsen dieser Länder weiter in die Höhe schossen und Spanien und Italien unter den ESM-Rettungsschirm hätten fliehen müssen, womit dieser Mechanismus angesichts der Größe der beiden Länder überfordert gewesen wäre.
Als sich die Zinsspanne zwischen den Staatsanleihen der Länder der Eurozone erneut vergrößerte, unternahm Draghi im Sommer 2012 seinen bisher gewagtesten Schritt. Am 26. Juli, einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in London, brachte er bei einer Investorenkonferenz in der britischen Hauptstadt die Märkte mit den inzwischen legendären Worten „whatever it takes“ zur Räson: Koste es, was es wolle. Die Botschaft kam an: Wer an den Finanzmärkten gegen den Euro wettert, hat Super-Mario als Gegner, der als EZB-Chef über unbegrenzte Geldreserven verfügt.
Viele Gegner in Deutschland
Unter dem Namen outright monetary transaction, oder OMT, hat die EZB Draghis Aussagen kurz darauf präzisiert. Die Zentralbank verspricht, in unbegrenzter Menge Staatsanleihen eines Landes zu kaufen mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren. Voraussetzung dafür ist, dass das Land sich an den ESM-Rettungsfonds wendet und sich dessen Bedingungen unterwirft: eine rigide Sparpolitik und harte Strukturreformen.
In Anspruch genommen hat das OMT-Programm noch kein Staat. Die bloße Ankündigung Draghis hat die Spekulationen gegen den Euro beendet und die Refinanzierungskosten der Länder an den Märkten gesenkt. Anfang November setzte Draghi geldpolitisch einen drauf, als er die Leitzinsen der Eurozone auf 0,25 Prozent senken ließ, der tiefste Wert seit der Gründung der EZB 1998.
Während Draghi in Italien bewundert wird und auch international viel Lob erhält, steht er in Deutschland immer wieder in der Kritik. Seine profiliertesten Gegner hierzulande sind der Ökonom Hans-Werner Sinn, Chef des Ifo-Instituts in München, der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und Bundesbankchef Jens Weidmann. Im Rat der Europäischen Zentralbank stimmte Weidmann gegen die Dicke Bertha, gegen das OMT-Programm und auch gegen die jüngste Zinssenkung. Seine Worte finden hierzulande viel Gehör.
Sinn, Stark und Weidmann argumentieren eher juristisch als ökonomisch, wenn sie sich um die Unabhängigkeit der Zentralbank sorgen und Draghi Verstöße gegen die europäischen Verträge vorwerfen. Unabhängig ist in den Augen dieser Ökonomen aber ohnehin immer nur derjenige, der ihre Meinung teilt. Am Telefon holt Jürgen Stark tief Luft, um dann in einem Kurzreferat zu erklären, warum die Maßnahmen der EZB unter Draghi und Trichet gegen den Maastrichter Vertrag verstoßen und Draghi mit seinen außergewöhnlichen Maßnahmen das Mandat der Zentralbank bereits weit überdehnt hat. OMT steht bei Stark daher für „outside the mandate transactions“, weil sie gegen das Verbot der Vergemeinschaftung der Haftung für Staatsschulden und gegen die direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank verstießen.
Draghis billiges Geld
Sinn und Stark reden gerne darüber, was Draghi und die EZB alles nicht machen dürfen. Auf Nachfrage, wie ihre Lösungsvorschläge für die Krise aussehen, plädieren sie mehr oder weniger offen für den Austritt einiger Krisenstaaten aus der gemeinsamen Währung. Welche Konsequenzen sich daraus für das weltweite Finanzsystem ergäben, können sie auch nicht voraussagen. Hauptsache, die einmal aufgestellten Regeln werden in der engstmöglichen Auslegung eingehalten. Sinn scheint fast zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht, das sein Urteil zur EZB vermutlich Anfang 2014 treffen wird, Draghis Politik des billigen Geldes für verfassungswidrig erklären wird.
Weidmann ist ein Befürworter der Sparpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren wirtschaftspolitischer Berater er bis zu seinem Wechsel zur Bundesbank war. Dass diese Politik die Krisenländer wirtschaftlich noch mehr zu schwächen droht, scheint ihn nicht zu stören, solange sich die EZB auf die Einhaltung der Preisstabilität konzentriert. Weidmann lässt sich in Interviews gerne mit Aussagen wie dieser zitieren: „Ich möchte, dass in Europa öffentlich und konkret darüber diskutiert wird, zu welchem Maß an wirtschaftspolitischer Integration wir bereit sind.“
Er möchte lieber diskutieren statt handeln. Das ist der größte Unterschied zwischen Draghi und Weidmann. Während der Deutsche noch zur Diskussion einlädt, hat der Italiener bereits eine Mehrheit für seinen Vorschlag organisiert. Draghis Credo lautet: „Das größte Risiko in Krisenzeiten ist nicht das Handeln, sondern das Nichthandeln.“
Lektion als Jugendlicher
Er hat diese Lektion auf die denkbar härteste Weise lernen müssen. Draghis Vater starb, als Mario 15 Jahre alt war, seine Mutter wenige Jahre später. So wurde er zum Familienvorstand für sich und seine Geschwister. Das Geld, das ihnen die Eltern hinterlassen hatten, legte ein Vormund in italienischen Staatspapieren in Lira an. Die grassierende Inflation in Italien in den siebziger Jahren mit Teuerungsraten von 15 Prozent fraß fast das Erbe auf. Draghi, der damals bereits Wirtschaftswissenschaften an der La Sapienza in Rom studierte, musste tatenlos zusehen, da der Vater verfügt hatte, dass sie das Geld erst mit der Volljährigkeit der jüngsten Schwester erhielten.
Draghi weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Inflation anfühlt. Als Meister der subtilen Kommunikation hat er diese Episode aus seinem Leben weiterverbreitet. Insofern ist es fast beleidigend, dass Draghi vorgeworfen wird, die EZB schüre mit der jüngsten Zinssenkung die Inflation in der Eurozone.
Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die Preissteigerung in der Eurozone ist so gering, dass Experten eher Angst vor einer Deflation haben. Wenn die Preise sinken, steigen die Sparguthaben im Wert, was zu einer Abwärtsspirale für die Konjunktur führen kann, weil keiner mehr Geld ausgeben will. Die Zinssenkung soll dem entgegenwirken, weil in einer Deflation auch die Schulden real ansteigen. Für Krisenländer wird es noch schwieriger, ihre Schulden zu bedienen. Wenn aber durch niedrigere Zinsen mehr Euro auf den Markt kommen und der Kurs dadurch sinkt, ist das für die Zentralbank ein willkommener Nebeneffekt: Die Wettbewerbsfähigkeit der Schuldenländer verbessert sich zumindest kurzfristig.
Berliner Politiker halten sich mit Aussagen über Draghi immer mit dem Hinweis auf die Unabhängigkeit der Notenbank zurück. Zu den wenigen Ausnahmen gehört der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Norbert Barthle, der seit Draghis Rede im Bundestag im Oktober 2012 ein Fan des EZB-Chefs ist. Er nennt ihn nur noch „den preußischsten aller Italiener“.Das wichtigste Argument von Draghis Kritikern ist der Reformdruck auf die schwächelnden Staaten: Wenn sie sicher sein können, dass die Notenbank eh einspringt, können sie es mit den Veränderungen langsam angehen lassen. In die Debatte hat sich kürzlich Draghis Doktorvater, der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Solow, eingemischt: „Natürlich braucht Europa Reformen. Das gilt für die Staaten des Südens, aber auch für Deutschland. Aber es kann doch nicht sein, dass die Notenbanker die Wirtschaft wissentlich in eine Depression stürzen, nur damit die Politik zum Handeln gezwungen wird“, sagte er in einem Interview mit der Zeit. Er wünsche sich, dass Draghi sich weiter so gegen den Abschwung stemmt. „Es ging uns nie um die reine Lehre, sondern immer auch um die praktische Anwendung“, sagt Solow.
Draghi ist ein gelehriger Schüler. „Wenn du überzeugt bist, dass etwas getan werden muss, musst du es tun“, sagt er, nur dann sei er mit seinem Gewissen im Reinen.
Kurz vor dem Abgrund
Auch mit drohenden Staatspleiten hat Draghi Erfahrungen gesammelt in seiner Zeit als Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums in den Neunzigern. „Wir waren nur Millimeter vom Abgrund entfernt“, erinnert sich sein Freund Francesco Giavazzi, Professor für Ökonomie am MIT in Boston. Er arbeitete damals gemeinsam mit Draghi im Finanzministerium. „Mario bleibt extrem cool in Situationen, in denen normale Leute längst durchdrehen. Er sagt dann immer: ‚Wenn wir das Richtige machen, kommen wir raus aus der Nummer.‘ Ich konnte in der Zeit nachts kein Auge zumachen, während Mario jeden Morgen bestens erholt ins Ministerium kam.“
Draghi sagt selbst oft, dass die EZB alleine die Krise nicht beenden, sondern nur Zeit für Reformen kaufen kann. Er hat immer betont, dass er nur ein Diener des Staates sei. Im aufgedrehten Palazzo, wie das politisch-wirtschaftliche Machtsystem in Rom genannt wird, macht ihn dies zu einem Fremdkörper – aber zu einem mit hohem Ansehen. Seit seiner Zeit im Finanzministerium gibt es in der italienischen Politik kaum einen, der einen so tadellosen Ruf genießt: „Wenn Mario Monti ein Katholik ist, dann ist Mario Draghi im Vergleich dazu der Papst“, sagt einer, der mit beiden gut befreundet ist.
Allein in der Trattoria
Durch seine exponierte Stellung als EZB-Präsident während der schlimmsten Krise der Währungsunion wird Draghi inzwischen überall erkannt. Er erträgt es mit seinem stoischen Gesichtsausdruck, hinter dem er auch bei zähen Sitzungen allergrößte Langeweile verbergen kann. Er ist kein typischer Römer. Sein fast britisches Understatement lädt selten zum in Rom beinahe obligatorischen Schwatz ein. Zu Hause im Parioli-Viertel im Norden der Stadt geht er am liebsten in die Trattoria „Ambasciata d’Abruzzo“. Meist isst er allein, setzt sich an einen abgelegenen Tisch. Er will kein Aufsehen. Der Wirt Roberto Poggi serviert ihm ohne zu fragen abbacchio al forno, Lammbraten mit Kartoffeln, eine römische Spezialität und Draghis Leibgericht.
In der Nachbarschaft in Rom kennt ihn jeder. Niemand verliert ein schlechtes Wort über ihn. Die Einzelhändler gegenüber haben zwar leichte Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, weil Carabinieri aus Sicherheitsgründen immer einige Parkplätze vor dem Haus der Draghis absperren müssen, sodass die Kunden der Bar, des Tabakladens und des Maßschneiders nicht mehr anhalten können. „Aber er will dieses Chaos ja auch nicht“, sagt der Schneider. Draghi ist gar nicht mehr so häufig in Rom, da seine Tochter Federica mit den zwei Enkeln in Mailand lebt, sodass er und seine Frau Serena zwischen Frankfurt, Rom und Mailand pendeln.
In der Banca d’Italia weisen noch eine Plakette und ein Ölgemälde im vornehmen Rosa Salon auf sein Wirken hin. Auf dem Bild ist Draghi akkurat gescheitelt wie immer. Im Gesicht hat er viele Falten, als habe der Künstler geahnt, dass Draghis Aufgabe in Frankfurt noch anstrengender wird. Wie immer trägt er einen dunklen Anzug, das Hemd ist weiß ohne Manschettenknöpfe. Seine Hand ruht auf einem Stapel Bücher, auf einem Tisch liegen drei Murmeln. Symbole für die Weisheit eines Mannes, der viel ins Rollen gebracht hat und anders ist als die üblichen Krakeeler des öffentlichen Lebens in Italien? Wenn er in sechs Jahren zum Ende seiner Amtszeit so alt ist, wie er jetzt schon auf dem Bild aussieht, hat er immer noch Zeit, als Staatspräsident die italienische Politik zu reformieren.