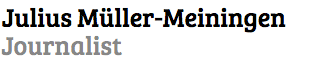Es heißt, es bringe Glück, wenn man in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II. seine rechte Ferse auf die Stierhoden setzt und sich im Kreis dreht. Die Hoden gehören dem Stier im Wappen der Stadt Turin, das in der achteckigen Zentralhalle in den feinen Marmorboden der berühmten Passage eingelassen ist. Kommt man am späten Nachmittag, ist im Hintergrund bereits das Klirren der Eiswürfel zu vernehmen.
Die Galleria Vittorio Emanuele II. ist so etwas wie der Mittelpunkt der Aperitifkultur, auch wenn sich neben den Luxusboutiquen die Fastfoodketten in den prächtigen Hallen eingenistet haben. Der Grund, weshalb die Mailänder hier das Turiner Wappen mit Füßen treten, mag auch darin liegen, dass es in Turin die ersten italienischen Kaffeehäuser gab, im Piemont die ersten Mundschenks an neuen Aperitifs experimentierten und eben nicht in der Lombardei. Turin und sein Stier sind also für die Mailänder immer noch eine Bedrohung, wenn es um die Erfindung des Aperitifs geht. Auch wenn das, was in anderen Ländern als „Happy Hour“ oder „Vorglühen“ bezeichnet wird, erst in Mailand zu wahrer Größe und Weltruhm gereift ist, wie die Mailänder nicht zu Unrecht behaupten. Ein Zentrum dieser ursprünglich erhabenen Kultur ist auch heute noch das „Caffè Campari“, das später in „Camparino“ umbenannt wurde und heute „Caffè Zucca“ heißt.
Die Häppchen der High Society
Davide Campari, Sohn des Campari-Erfinders Gaspare, übernahm 1915 das Lokal als „Camparino“ in der noblen und nach dem Einheits-König benannten Galleria Vittorio Emanuele II. Der Bitter war da bereits ein etablierter Drink, den die Mailänder Intellektuellen mit der High Society schlürften und dazu Häppchen aßen. Schon damals bekamen Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und später auch Arturo Toscanini auf dem Rückweg von der Scala einen in Eissplitter getauchten Glasbecher von Kellnern in weißer Livree. Heute noch hängt der elegante, schmiedeeiserne Lampenschirm von der hohen Decke, ziehen bunte Wandmosaike die Blicke auf sich und diskutieren im Séparée Geschäftsleute auf der Suche nach der besten Strategie.
Die Szenerie wird von der Signora an der Kasse überwacht, die nicht nur die Stammgäste, sondern auch die weiß livrierten Baristi unter Kontrolle hat. Draußen in der Passage, auf Tischen mit cremefarbenen Tischdecken, stehen nahezu den ganzen Tag viele kleine Gläschen, in denen viele braune, ein paar rote und wenige weiße Getränke schaukeln. Nun hat ausgerechnet an diesem Tag niemand ein Glas Campari in der Hand, stattdessen nippen alle an einem Getränk in brauner Farbe. „Rhabarber-Likör mit Soda“, klärt eine zierliche ältere Dame am Tresen auf, die sich gerade ein Kanapee in den Mund schieben will. Es wäre nicht überraschend, breitete sich vom „Caffè Zucca“ auch diese Mode weiter aus und dem Rhabarber-Drink gehörte das 21. Jahrhundert.
Schildläuse im Glas
Dabei soll auch im Campari Rhabarber sein, als eine von mehr als 60 Zutaten. Die genaue Zusammensetzung des Getränks ist bis heute geheim; nur der Firmenchef sowie ein achtköpfiger Mitarbeiterstamm kennen sie. Ein paar Zutaten sind aber doch bekannt: Unter anderem sind Orangenschalen, Chinin und die ätherischen Öle aus der Rinde des tropischen Kaskarillabaums enthalten. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, sein roter Farbton, der eigentlich Leidenschaft und Sinnlichkeit signalisieren soll, stamme aus den getrockneten und zermahlenen Panzern unappetitlicher Schildläuse. Bis vor kurzem war das tatsächlich noch der Fall, inzwischen werden angeblich chemisch hergestellte Farbstoffe verwendet, was die seltene, aber existierende Spezies der gesundheitsbewussten Trinker nicht gerade beruhigt.
Zielgruppe des Campari sind aber eher diejenigen, die ihren Nachmittag am liebsten mit einem Gläschen in der Hand beginnen, also fast alle Italiener. Doch im Gegensatz zu ihren nordischen Nachbarn verstehen sie es, spätestens nach dem zweiten Becher Schluss zu machen. Die Kultur des Aperitifs ist immer auch eine Frage der Interpretation.
Aus Frankreich schwappte diese Mode Ende des 19. Jahrhunderts in den Piemont und seine Hauptstadt Turin herüber. In norditalienischen Kellern panschten damals die Mundschenks um die Wette auf der Suche nach einem akzeptablen, neuen Geschmack.
Herkunft: Holland
Schließlich konnte man in den gerade in Mode gekommenen Cafés nicht den ganzen Tag Kaffee trinken. Es bedurfte eines Getränks, das vor der Mahlzeit bereits die Produktion von Magensaft anregte und vor allem einen Vorwand zur geselligen Zusammenkunft bot. Auch der Branntweinschenk Gaspare Campari aus Cassolnovo bei Novara experimentierte um 1860 in seinem Keller, um einen Bitter herzustellen, wie er damals in den Niederlanden getrunken wurde. „Bitter all’uso d’Hollanda“ nannte Campari seine Entdeckung, die nicht nur in seiner „Bar der Freundschaft“ einschlug, sondern bald überall kopiert wurde. Als „Bitter Campari“ ließ der Schenk das Original schützen und jeder Wirt, der es vertrieb, musste einen entsprechenden Schriftzug vor seiner Kneipe aufhängen. Seit 1904 wird der Bitter in Sesto San Giovanni bei Mailand produziert, und Mailand war natürlich auch die bessere Adresse, um ein neues Getränk zu vermarkten. So ist es kein Zufall, dass die erste Anzeige 1880 im Mailänder Corriere della Sera erschienen war und dass Gaspares Sohn Davide schließlich die prestigeträchtige Bar in der noblen Einkaufs-Passage übernahm. Mit Campari gab es im rastlosen Mailand endlich einen Grund, sich auf ein Gläschen niederzulassen.
Campari ist unterdessen zu einem Weltkonzern mit 2000 Mitarbeitern aufgestiegen, der sich andere Firmen einverleibt und Marken wie Aperol, Cynar, Ouzo 12 oder Cinzano umfasst. Dass Campari immer noch als Inbegriff des Aperitifs gilt, hat mit der größten Leistung seiner Macher zu tun. Sie haben verstanden, dass gar nicht so sehr ihr bittersüßes Gesöff im Mittelpunkt stehen muss, sondern das Drumherum viel wichtiger ist. Im Drumherum ist Campari wirklich gut. Das gilt nicht nur für das in Italien meist im Getränkepreis inbegriffene, üppige Aperitif-Buffet, die Bars sowie die Menschen, die dort zusammenkommen. Sondern auch für alles, was den Bitter zur Marke hat werden lassen.
Das Drumherum ist wichtiger
Besonders in Kunst und Werbung setzte man Maßstäbe. Die Firma engagierte hervorragende Künstler wie den Futuristen Fortunato Depero, der 1932 unter anderem das berühmte kegelförmige Campari-Soda-Fläschchen entwarf. In der Galleria Campari, einer aufwendig gemachten Ausstellung zum 150. Geburtstag am heutigen Firmensitz in der nicht eben reizvollen Mailänder Industrie-Vorstadt Sesto San Giovanni, kann man etwa auch Federico Fellinis 1984 gedrehten Campari-Werbespot sehen, den ersten überhaupt. Darin fährt eine hübsche Zugreisende an etlichen tristen Landschaften vorbei und wird erst glücklich, als der schiefe Turm von Pisa und eine Flasche Campari vor ihr auftauchen. Heute werben Stars wie Salma Hayek oder Eva Mendes für Campari und lösen in Männerhirnen den Fehlschluss aus, man käme ihnen beim Trinken näher. Dabei heißt es, den meisten Frauen sei Campari zu bitter.
Vielleicht ist das aber auch nur eine von vielen Geschichten, die um die Marke gestreut werden, genau wie jene, dass der weltweit höchste Pro-Kopf-Verbrauch des Bitters nicht in Mailand, sondern auf der Karibikinsel St. Lucia stattfindet.