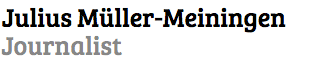Ob Matteo Renzi sich wirklich den richtigen Berater gesucht hat? Immer wieder tauchte der amerikanische Kampagnen-Guru Jim Messina in den vergangenen Wochen im Palazzo Chigi auf, dem Sitz des italienischen Ministerpräsidenten in Rom. Für Premier Renzi geht es um alles beim Referendum am 4. Dezember, bei dem die Italiener eigentlich nur über eine Verfassungsreform abstimmen sollen, aber auch ein Urteil über die Regierung insgesamt fällen werden. Messina bewerkstelligte die Wiederwahl von US-Präsident Obama, beriet aber auch den ehemaligen britischen Premierminister David Cameron bei seiner im Desaster geendeten Anti-Brexit-Kampagne. Und zuletzt unterstützte er die misslungene Wahl von Hillary Clinton zur US-Präsidentin. Jetzt arbeitet er für Renzi. Keine exzellenten Aussichten für den Italiener, in den Umfragen liegen die Gegner der Reform vorne.
Die Bedeutung der Volksabstimmung geht längst über die eigentliche Frage des Referendums hinaus. Ein „Nein“ der Italiener zur Verfassungsreform, die Renzi zum Kernprojekt seiner politischen Bemühungen erklärt hat, käme einem Misstrauensvotum gegen den 41-jährigen Premierminister gleich. Die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen sind kaum abzuschätzen. Renzis Rücktritt wäre wahrscheinlich. Monate der Unsicherheit lägen dann vor Italien und der EU. Ein Zeichen für die angespannte Situation auf den Finanzmärkten sind der starke Anstieg der Zinsen für zehnjährige italienische Staatsanleihen sowie der Anstieg des sogenannten Spread, der den Zinsaufschlag auf italienische Papiere im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen misst. Von einem Tiefstand im August bei 112 Punkten schnellte er zuletzt auf über 180 Zähler nach oben. Anlegern zufolge ist die Wahrscheinlichkeit eines Euro-Austritts Italiens inzwischen höher als der Griechenlands.
Lange war man sich in Italien einig, dass das aktuelle parlamentarische System die Entwicklung des Landes bremst. Um autoritäres Regieren wie zu Zeiten des Faschismus zu vermeiden, pendeln Gesetzte seit der Nachkriegszeit lange zwischen zwei gleichberechtigten, aber mit verschiedenen Mechanismen gewählten Kammern hin und her. Unterschiedliche Mehrheiten waren die Folge, ein Kreuz für die Exekutive. Die nach Renzis Reform-Ministerin Maria Elena Boschi benannte und bereits von beiden Kammern verabschiedete Verfassungsreform sieht vor, den Senat zu einer untergeordneten Kammer zu degradieren und seine Mitglieder von über 300 auf 100 zu reduzieren. 500 Millionen Euro will die Regierung so einsparen. Regierungen wären nicht mehr auf die Mehrheit im Senat angewiesen, über die schon viele Ministerpräsidenten stolperten. Den Befürwortern zufolge wären Stabilität, die Beschleunigung der Gesetzgebung und damit auch wirtschaftliches Wachstum die Folgen.
Es gibt begründete Zweifel an diesem Optimismus. Verfassungsrechtler bezeichnen das Boschi-Gesetz als stümperhaftes Stückwerk, mithilfe dessen Populisten in Zukunft ihre Ideen im Schnelldurchlauf umsetzen könnten. Es gibt ein weiteres Problem: Durch ein seit Juli geltendes neues Wahlgesetz für das Abgeordnetenhaus könnte künftig eine Partei, die etwas mehr als 20 Prozent im ersten Wahlgang erreicht, durch einen Sieg in der Stichwahl an die Macht gespült und dann nicht mehr vom Senat gebremst werden. In Umfragen liegt derzeit etwa die euro- und europaskeptische 5-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo vorne. Auch deswegen ist immer wieder die Rede vom drohenden Euro-Austritt Italiens als mittelbarer Folge des Referendums.
Renzis Ruf als Reformer hat nach zweieinhalb Jahren an der Macht gelitten. Grund dafür ist vor allem die Wahrnehmung, dass Italien nach fast zehn Jahren Rezession und Stagnation wirtschaftlich auf der Stelle tritt. Trotz einiger Teilerfolge wie der Reform des Arbeitsmarktes, die 650 000 neue Jobs geschaffen haben soll, liegt die Arbeitslosigkeit immer noch bei elf Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 39 Prozent, eine ganze Generation scheint für den Arbeitsmarkt verloren. Die Staatsschulden haben den Stand von 2250 Milliarden Euro (133 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) erreicht, die Wachstumsprognosen sind weiterhin schlecht. Der Internationale Währungsfond schwächte seine Prognose zuletzt auf 0,9 Prozent Wachstum im kommenden Jahr ab.
All dies trägt zur Skepsis gegen die Regierung und ihr Reformprogramm bei. Auch der Kampf gegen die Bürokratie schreitet voran, zeigt aber immer noch keine spürbare Wirkung. In der Regierung rühmt man sich für Steuersenkungen in Höhe von 33 Milliarden Euro, sie sind vor allem durch Einsparungen im Staatshaushalt finanziert. Doch die EU-Kommission in Brüssel verlangt eine konsequente Reduzierung der Neuverschuldung, der Italien weiterhin nicht nachkommt. Dennoch schlossen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Renzi vor Tagen Frieden, die Budget-Verstöße Italiens werden erneut toleriert. Brüssel will der italienischen Regierung vor dem Referendum keine zusätzlichen Schwierigkeiten bereiten, die dann auf die ganze Währungsunion zurückfallen könnten. Wegen der unkalkulierbaren, möglicherweise europaweit spürbaren Folgen eines Misserfolgs von Renzi hofft man auch in Brüssel auf ein „Ja“ der Italiener zur Verfassungsreform.
Dazu kommt, dass Renzi inzwischen von innenpolitischen Gegnern wie umzingelt wirkt. Alle Oppositionsparteien haben sich gegen die Verfassungsreform ausgesprochen, überdies hat der Premier mit dem Widerstand des linken Flügels in seinem eigenen Partito Democratico (PD) zu kämpfen. Seit Wochen sind Renzi und die Seinen deshalb auf Wahlkampftour, viele Italiener sind noch unentschlossen. Auch im Zuge der US-Präsidentschaftswahl versucht Renzi seine Gegner nun als veränderungsunwilliges Establishment darzustellen und sich selbst neuen Lack als Reformer zu verleihen. Die Realität in den Augen vieler Italiener ist anders. Danach zählt der Ministerpräsident nach zweieinhalb Jahren an der Macht längst selbst zum politischen Inventar in Rom. Renzis politisches Talent und seine Wirkung auf die Massen sind allerdings nicht zu unterschätzen. Zudem hegt er mit Blick auf die letzten wichtigen Wahltermine in der Welt eine große Hoffnung. Die Umfrageinstitute hätten sich in diesem Jahr nicht das erste Mal geirrt.