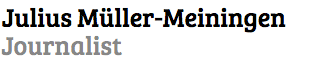Es ist dunkel, nur im rechten Seitenschiff der Basilika flackern ein paar Kerzen. Im Halblicht wartet eine Handvoll Menschen vor der Sakristei. Einige haben Tragetaschen mit Wasserflaschen dabei. Dann dringen Geräusche aus dem Raum hinter der schweren Holztür. „Das Herz Gottes“, ruft der Exorzist mit bebender Stimme. „Die Hände Gottes, die Arme Gottes, das Fleisch Gottes.“ Plötzlich dringen Geräusche nach draußen, die die Wartenden bis ins Mark erschüttern. „No, noo, noooo, non é vero!“ Nein, das stimmt nicht, krächzt drinnen eine verzerrte Stimme. Es klingt so, als sei die kleine, grauhaarige Frau, die gerade noch in der Schlange wartete und nun hinter der Tür in der Sakristei ist, wirklich vom Leibhaftigen besessen.
„Feigling, du hast dich versteckt, komm heraus!“, brüllt jetzt Padre Fiorenzo Castorri, der Exorzist. Er meint den Teufel. Don Castorri murmelt kaum verständlich Gebete, das Vater Unser, ein Ave Maria. „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dann wieder Schreie: „No, noo, noooo!“ Würgegeräusche und lautes Husten dringen aus der Sakristei. Ist das der Moment, um einzuschreiten? Auch die anderen Wartenden vor der Sakristei sind verstört. Eine jüngere Frau hat die Augen weit aufgerissen. „Ich habe Angst“, sagte sie zu ihrem Mann, „komm, wir gehen!“ Der Mann will bleiben. Beide sind extra aus Foggia in Süditalien hergekommen, um sich segnen zu lassen. Drinnen ist jetzt ein eisernes Klappern zu hören. „Das Halsband“, sagt die Frau. „O mio Dio!“ Oh mein Gott.
Das Halsband. Don Castorri hatte es zuvor aus dem Tabernakel in der Kappelle des Heiligen Vicinius geholt. Nach ihm ist die romanische Basilika in Sarsina benannt. Vicinius soll sich zu Beginn des 4. Jahrhundert als Eremit auf einem Berg in der Nähe zurück gezogen haben. Mit dem eisernen, aus zwei Gliedern bestehenden Halsband tat er Buße. Seither verehren Katholiken die Reliquie und sprechen ihr Kräfte gegen das Böse zu. Dass Sarsina die Heimatstadt des römischen Komödiendichters Plautus ist und ein antikes Amphitheater zu bieten hat, interessiert hier fast niemanden. Alle kommen sie, um sich vom Exorzisten oder seinen beiden Helfern das Halsband auflegen zu lassen. 50 000 Menschen sind es jedes Jahr, die deswegen in diesen kleinen, entlegenen Flecken in den unwirtlichen Apenninen-Hügel der Emilia-Romagna pilgern. Nach Sarsina, in die Hauptstadt der Besessenen.

Das Halsband des Heiligen Vicinius (Foto: Max Intrisano).
Wenig später sitzt ein zwei Meter großer Hüne erschöpft in der Sakristei. Don Castorri gibt ein Bild der Verwüstung ab. Der Teufel hat ihn wieder mal gefordert. Sein Kopf ist gesenkt, die grüne Stola über dem weißen Messgewand ist verrutscht. Castorris Haare sind zerzaust, als er den Mund zum Sprechen öffnet, sind abgenutzte Zähne zu erkennen. Vor ihm stehen zwei Stühle. Rechts ein Tischchen mit Kruzifix, Weihwasser, dem Buch mit dem Ritus des seit 1614 geltenden und 1999 vom Vatikan aktualisierten Großen Exorzismus. Und dem eisernen Halsband des Heiligen. Der Boden vor ihm ist voller kleiner Pfützen. „Weihwasser“, sagt der Exorzist. Dann erzählt er von der alten Frau, die eben den Raum verlassen hat. Sie kommt jede Woche zu ihm, um sich den Teufel austreiben zu lassen.
Der Teufel hat Konjunktur, zumindest in Italien. Papst Franziskus hat in seinen Predigten oft von ihm gesprochen. Die katholische Kirche in Italien setzt immer mehr Exorzisten ein. Über 200 sollen es zwischen Südtirol und Sizilien sein. Auch im katholischen Polen, wo etwa 125 Exorzisten tätig sind, werden die Teufelsaustreiber wieder mehr. Außerdem hat die Zunft gerade erst von ganz oben Anerkennung bekommen. Der Papst erkannte im Juni die Internationale Vereinigung der Exorzisten (AIE) offiziell an und ermutigte die weltweit etwa 400 offiziell tätigen Teufelsaustreiber in ihrer Arbeit. Bei der AIE ist man überzeugt, dass die Fälle von Besessenheit in den letzten Jahren zugenommen haben. Der Grund: In Gesellschaften, in denen Aberglaube, Okkultismus, Esoterik, aber auch Skepsis und „Unglauben“ auf dem Vormarsch sind, sei der Dämon am Werk. Ganz nach der Devise, die auch Franziskus am vierten Tag seines Pontifikats ausgab: „Wer nicht zu Jesus betet, betet zum Teufel.“
Die alte Frau mit den kurzen Haaren ist nun auf der Toilette. Von dort dringen Würgen, Spucken und unterdrücktes Brüllen bis zur Sakristei. „Sie ist besessen“, sagt Don Castorri, „aber es geht ihr schon besser“. Dann schildert der Exorzist sein heutiges Treffen mit der Frau in einem Dialog zwischen Komik und Abscheulichkeit. „Wie geht’s“, habe er gefragt. „Ich habe Hämorrhoiden“, entgegnete die Frau. Don Castorri sagte: „Dort steckt er, der Teufel!“ Dem Ehemann habe er dann den Weihwasserwedel gegeben, um die entsprechende Stelle zu besprengen. „Nehmen Sie!“, sagte der Exorzist. Die Frau sei von ihrem Stuhl aufgesprungen. „Ganz klar“, sagt Don Castorri, „der Teufel steckte in den Hämorrhoiden!“
Die Menschen, die zu ihm kommen, hätten oft viele Arztbesuche hinter sich. Bei der Frau, die eben sein Zimmer verlassen habe, seien alle Ärzte und Psychiater ratlos gewesen. Schließlich war es der Ehemann, der sie zu ihm in die Basilika geführt habe. „Sie können sich nicht vorstellen, wie sie sich gewehrt hat! Zu fünft mussten wir sie über die Schwelle der Kirche schleppen“, erzählt der 63-Jährige.„Der Teufel scheut die Kirche“, sagt der Exorzist. Inzwischen käme die Frau von selbst, mit zwei Freundinnen, die während des Exorzismus den Rosenkranz beten und ihrem Mann. Was am Besten gegen den Teufel funktioniert? „Weihwasser und Gebete.“ Deshalb bringen die Besessenen dem Exorzisten literweiße Mineralwasser mit. Don Castorri soll es weihen, dann nehmen es die Betroffenen wieder mit und trinken es zuhause.
Die einzige wahre Garantie sei jedoch das Halsband des Heiligen Vicinius. „Mein Satan-Detektor“, sagt der Exorzist und streicht beinahe liebevoll über das Eisen. „Er deckt jede Art von Besessenheit auf.“

Don Castorri treibt einem Besessenen den Teufel aus (Foto: Max Intrisano).
Schräg gegenüber der Kirche, im Laubengang vor dem Drago’s Café stehen ein paar ältere Männer zusammen. Sie alle haben sich in ihrem Leben schon viele Male das Halsband des Vicinius umlegen lassen. Einer von ihnen erzählt: „Als ich ein Kind war, habe ich gesehen, wie sie einen Besessenen zu acht in die Kathedrale schleppten. Er wehrte sich, drinnen sprach er plötzlich vier Sprachen. Als er die Schwelle der Basilika übertreten hatte, würgte er und spuckte Glasscherben und Nelken aus.“ Die anderen nicken. Auch sie haben solche Episoden als Kinder miterlebt. Schon immer zog das Halsband und seine angebliche Wirkung gegen das Böse Menschen aus ganz Italien an.
Die Jüngeren sind skeptisch. Daniele, ein 25-Jähriger Student, der vor dem Café raucht, sagt: „So ein Unsinn! Ich glaube nicht an den Teufel. Für mich sind das psychisch kranke Menschen, denen geholfen werden muss.“ Auch Francesca, die junge Frau an der Bar, hat ihre Zweifel an der Existenz der Dämonen. „Mich schaudert das alles, aber ich glaube, dass wir hier in Sarsina besonders vor dem Bösen geschützt sind.“ Wegen des Halsbands. Was Sie über den Exorzisten denkt? „Er macht mir Angst.“
Don Castorri ist erst seit fünf Jahren hier. Damals nominierte ihn der Bischof von Cesena-Sarsina als Nachfolger des bisherigen Teufelsaustreibers. Seither wirkt der Pater völlig autonom. Zwei Priester helfen ihm bei den einfachen Segnungen mit dem Halsband. Vier besessene Frauen kommen im Wochenrhythmus zu ihm. Echte Besessenheit, die einen Exorzismus notwendig mache, sei äußert selten. „Die Frau am Samstagmorgen spuckt mich immer an“, erzählt Castorri und schüttelt den Kopf. Genehmigungen für seine Exorzismen vom Bischof braucht er nicht. Ob jemand psychisch krank sei und einen Arzt brauche, das meint Don Castorri leicht zu erkennen. „Die wirklich Besessenen kommen nicht von selbst“, versichert der Exorzist.

Don Castorri in Aktion (Foto: Max Intrisano)
Er ist der Chef in der Basilika und Pendler in die Welt des Bösen. Gelernt hat er sein Handwerk bei zwei Videokonferenzen in Bologna. Dort verfolgte er die Exorzismus-Seminare, die jedes Jahr in der päpstlichen Universität Regina Apostolorum in Rom abgehalten werden. Das ist der Sitz der Legionäre Christi, die wegen ihres mexikanischen Ordensgründers Marcial Maciel in Verruf geraten waren. Der über Jahrzehnte von seiner Kongregation verehrte Priester, ein notorischer Straftäter, war Vater mehrerer Kinder, die er neben anderen Minderjährigen teilweise sexuell missbrauchte. Und dann hat Don Castorri noch die Bücher und die Telefonnummer von Pater Gabriele Amorth. „Wenn ich Zweifel habe, rufe ich ihn an.“
Don Amorth ist der Nestor der italienischen Exorzisten. Er hat den internationalen Exorzistenverband gegründet und ist dessen undiplomatischer und gesprächiger Ehrenvorsitzender. Man kann den 89 Jahre alten Amorth auf der Krankenstation der Gesellschaft des Heiligen Apostel Paulus in Rom besuchen, einem übergroßen Gebäudekomplex in der Nähe der Basilika Sankt Paul vor den Mauern. Schnell steuert das Gespräch auf den Lieblingsfeind des ehemaligen Chefexorzisten der Diözese Rom zu, welcher überraschenderweise nicht der Teufel ist. „Will man den Glauben verlieren, dann genügt es in den Vatikan zu gehen“, sagt Amorth voller Ernst. Damit meint er aber nicht etwa die Päpste. Von Paul VI. und Johannes Paul II. sind ihm schließlich jeweils drei regelkonforme Exorzismen bekannt. Benedikt XVI. und Franziskus, die selbst nicht gegen die Dämonen aktiv seien, stünden eindeutig auf der Seite seiner Zunft, das hätten sie in Grußworten und öffentlichen Ermunterungen bewiesen. Zum katholischen Spitzenpersonal sagt Amorth nur noch so viel: „Auch ein Papst ist ständig in Versuchung.“
Dem Pater werden über 70 000 Exorzismen nachgesagt, obwohl der alte Mann mit dem eindrucksvollen Kahlkopf behauptet, er habe sie selbst nie gezählt. Auf dem Flur, auf dem auch Don Amorth sein Zimmer hat, vertreibt gerade eine Ordensschwester einen alten Mann im Rollstuhl. „Hau ab, ich muss arbeiten“, blafft die Nonne den Alten an und wirft etwas unvermittelt die Frage nach Gut und Böse auf. Der Alte rollt davon und jammert: „Ich muss doch nur mal.“ Don Amorth hingegen ist immer noch sehr angesehen in der Szene, hat aber Probleme mit dem Gehen. Sein Talent ist weiterhin gefragt. Erst vergangenen Samstag hatte er wieder einen Exorzismus. „Die Frau kommt seit zehn Jahren aus Florenz zu mir und scheint endlich der Befreiung nahe zu sein.“
„Sie kommen aus Deutschland?“, fragt Don Amorth unvermittelt. „Die Deutschen sind gegen Exorzismen.“ Das hätte mit Martin Luther und dem Fall der Anneliese Michel zu tun. Die 23-jährige psychisch kranke Studentin aus Unterfranken starb 1976 an Unterernährung, nachdem zwei Priester 67 Exorzismen an ihr vorgenommen hatten. Die Verantwortlichen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Seither, sagt Amorth, hätten es die wenigen, fernab aller Öffentlichkeit operierenden Exorzisten nördlich der Alpen noch einmal schwerer. Er befindet jedoch streng: „Wer nicht an Exorzisten glaubt, ist Sklave des Dämons.“
Damit ist man allerdings in illustrer Gesellschaft. Auch unter Priestern und Bischöfen gibt es viele Skeptiker, ein Kardinal habe ihm sogar einst gestanden, nicht an den Teufel zu glauben, was zu einem denkwürdigen Disput zwischen dem Exorzisten und dem Prälaten führte. „Ich empfehle Ihnen ein höchst interessantes Buch“, sagte Amorth. „Welches denn?“, wollte der Kardinal wissen. „Das Evangelium“, sagte der Exorzist. Die zahlreichen im Neuen Testament erwähnten Dämonenaustreibungen Jesu Christi sind die dogmatische Grundlage der Exorzisten. Sie nehmen den Heiland beim Wort. Und haben andererseits offenbar nichts gegen die Fantasien Hollywoods. Der Film von 1973? „Sehr gut, er steht bei mir im Regal.“ Besessenheit und Exorzismen seien sehr authentisch nachgestellt. Niemand habe mehr an Exorzisten gedacht. „Der Film hat uns wieder bekannt gemacht“, sagt Amorth.
Man möchte dann noch wissen, ob die Kräfte des Bösen bei langjährigen Exorzisten irgendwelche Spuren hinterlassen. „Ich bin seit 30 Jahren aktiv und hatte nie Probleme“, sagt Don Amorth. Allerdings seien manche Teufelsaustreiber durchaus geplagt. Der Dämon zeige sich dann etwa in Lampen, die sich nachts von selbst ein- und ausschalteten. Herunterfallende Teller kämen auch vor, und körperliche Pein.
Don Castorri in Sarsina, der viermal pro Woche sein Stelldichein mit dem Teufel hat, kann davon ein Lied singen. Er berichtet, dass sich eine Zeitlang von selbst ein Licht in seiner Wohnung, gleich oben neben der Basilika, eingeschaltet habe. Die Sache habe sich dann aber mit dem Einsatz von Weihwasser und ein paar Befreiungsgebeten wieder einrenken lassen. Schlimmer muss es im vergangenen Sommer gewesen sein. Don Castorri rückt nicht recht raus mit der Sprache, er sagt nur soviel: „Mein Glauben, meine Keuschheit. Es war nicht leicht.“
Zum Schluss legt der Exorzist von Sarsina dem Besucher ungefragt das eiserne Halsband um. Das Eisen fühlt sich kalt an, es ist unangenehm eng. Der Pater murmelt. „Heiliger Vicinius, bete für uns“, sagt Don Castorri müde. Dann nimmt er das Eisen wieder ab. Der Exorzist reicht die Hand zum Gruß. „Tutto a posto“, sagt er. Alles in Ordnung.